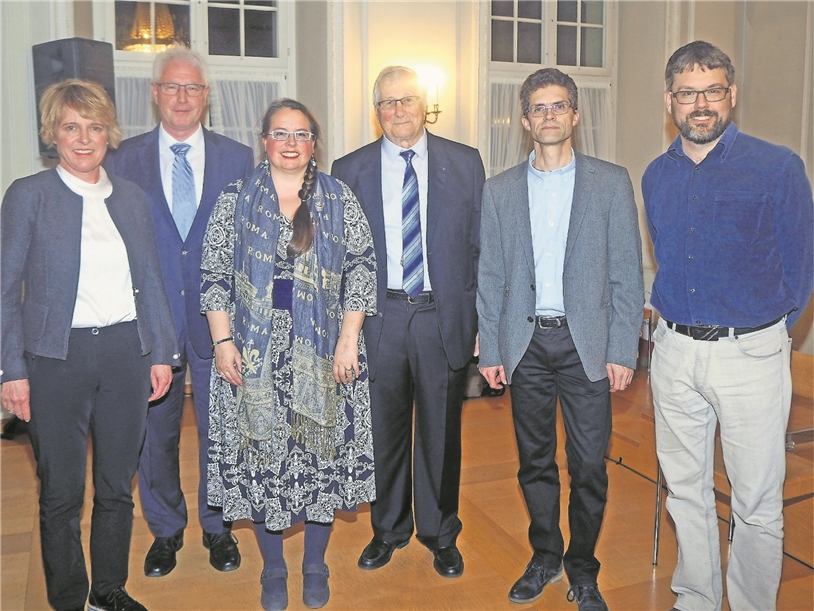
68er-Bewegung im Rückblick: Die «Grosse Weigerung»
«Die Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1968 wirkte in Zürich wie ein Schock: Zum ersten Mal seit den von der Wirtschaftskrise belasteten dreissiger Jahren, in denen es zu Zusammenstössen mit Frontisten und Kommunisten kam, haben am Samstagabend in Zürich schwere Krawalle stattgefunden. Die bis in die Morgenstunden dauernde Strassenschlacht in der Innenstadt forderte 41 Verletzte (15 Polizisten, 7 Feuerwehrmänner und 19 Demonstranten), 169 Demonstranten wurden verhaftet», meldete die «Neue Zürcher Zeitung». Das «Zofinger Tagblatt» schrieb von «Blutigen Krawallen in Zürich». Wie kam es zu der nach diesem Ereignis genannten «68er Bewegung» und was hat sie bewirkt? Mit diesen Fragen befasste sich der Vortrag von Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Fribourg. Sein Vortrag befasste sich jedoch nicht bloss mit dem Jahr 1968, sondern mit den «langen 1968er-Jahren» im Zeitraum von 1950 bis 1970 und den damals stattfindenden gesellschaftlichen Umbrüchen.
Suche nach einer neuen Zukunft
Zentrales Anliegen der Generation, die den Zweiten Weltkrieg selber noch hautnah erlebt hatte, war kein Krieg, kein Auschwitz, keine Atombomben mehr. Diese Ängste standen bei den nachher Geborenen nicht im Mittelpunkt. Vor allem die Studierenden an den Hochschulen übten Grundsatzkritik an den herrschenden Verhältnissen («Grosse Verweigerung»). Ihre Vision und Ideologie zielte auf Mitbestimmung, Demokratisierung, Emanzipation, Selbstbestimmung und -organisation und ihr Widerstand galt dem Militarismus, Kapitalismus und Faschismus, wobei der Vietnam-Krieg ein zentrales Thema bildete. Zwischen 1960 und 1970 nahm die Zahl der Studierenden an allen Schweizer Universitäten massiv zu, ebenfalls die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, was dann die Schwarzenbach-Initiative zu bremsen versuchte. Es war eine Zeit des Umbruchs und der Visionen von einer neuen, fortschrittlichen Zukunft. Wegbereiter und -begleiter der 68er-Bewegung waren die Anti-Atombewegung, Ostermärsche, die «Junge Linke» der PdA, die «Fortschriftliche Studentenschaft Zürich» und «Nonkonformisten» (Intellektuelle, Künstler und Schriftsteller). Max Frisch, Lucius Burckhardt und Markus Kutter gaben die Schrift «Achtung die Schweiz» heraus und am 3. Juli 1960, wenige Tage nach dem Globus-Krawall, unterzeichneten Max Frisch, Gottfried Honegger und Walter Matthias Diggelmann das «Zürcher Manifest».
Unkonventionell agiert
Die 68er-Bewegung setzte in öffentlichen Protestaktionen neue symbolische Aktionen ein: Happenings, sit-ins, go-ins, teach-ins, entdeckte das Strassentheater, führte öffentlich Kurzfilme als Agitorp-Mittel auf und machte überraschende Störaktionen sowie Besetzungen. Damit sollten Veränderungen in der Lebensweise und Lebensform eingeleitet werden. In der Schweiz stiess sie damit an Grenzen. Der Föderalismus schuf unterschiedliche Kulturen, Sprachregionen und Prioritäten sowie die Kritik an der Armee stiess auf Ablehnung, zu gross war die Spannung im Zeitalter des Kalten Krieges. Damir Skenderovic entwarf in freier Rede ein anschauliches, mit vielen Fakten versehenes Bild von der 68er-Bewegung. Abschliessend stellte er die Auswirkung und Bedeutung der Bewegung zur Diskussion. Gesichert ist, dass sich bezüglich Gleichberechtigung, Werten und Weltanschauung einiges im Sinn der Bewegung geändert hat. Umstritten in der Diskussion war, ob sie auch zur Grundlage einer gewaltbereiten Linken und/oder einer populistische Gegenströmung geworden ist.





