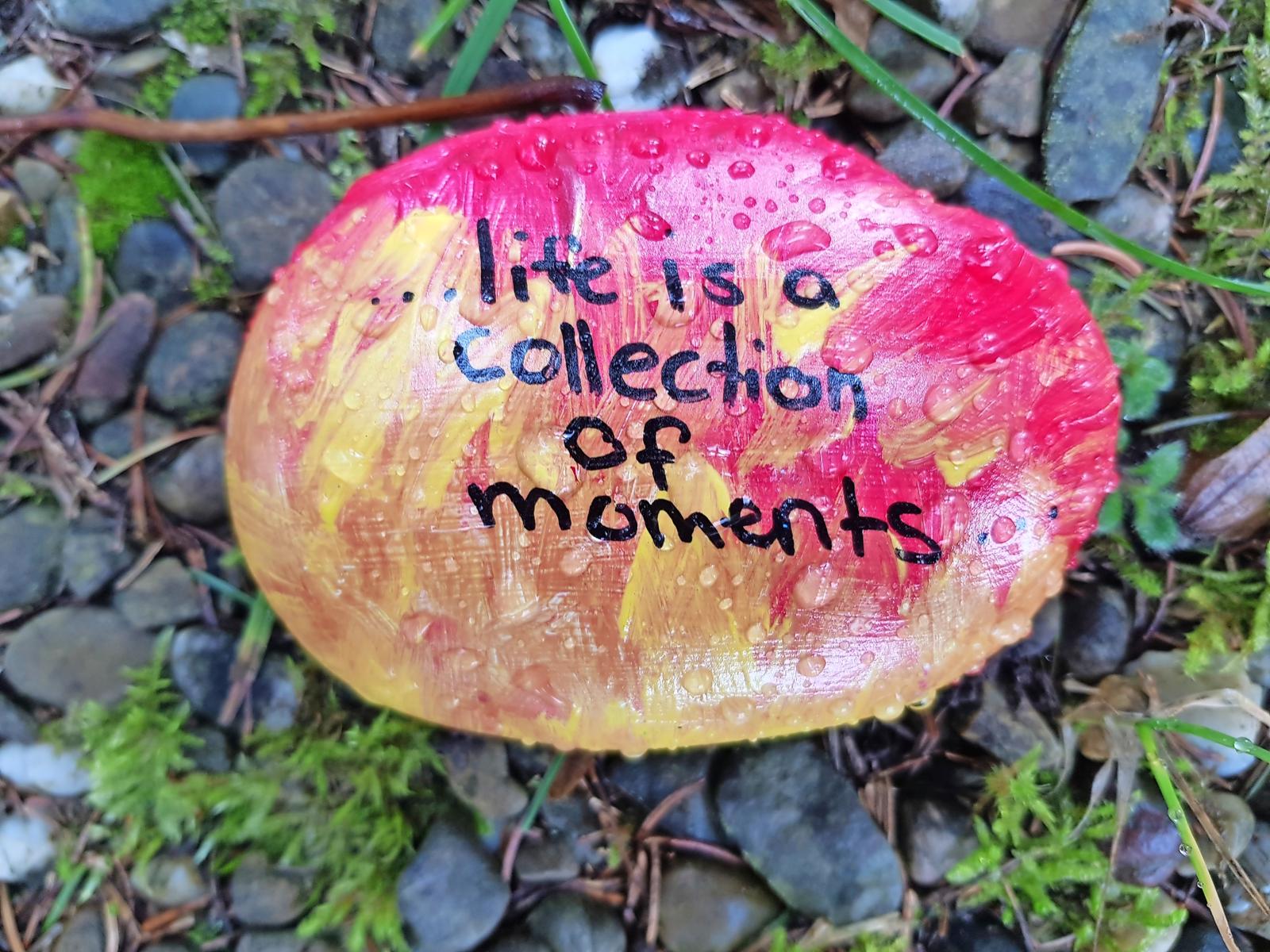Mehr Wohnraum für die kleine Eule: Kehrt der Steinkauz in die Region zurück?
Ein flacher Kopf, stechend gelbe Augen und weisse Augenbrauen. Rund 20 Zentimeter gross und zwischen 140 und 200 Gramm schwer. Gut getarnt dank dem bräunlichen Gefieder mit den hellen Flecken. In der Dämmerung und nachts ist er aktiv und jagt dann Mäuse, grosse Laufkäfer, Heuschrecken, Maulwurfs- und Feldgrillen. Bewohnt offene, strukturreiche Kulturlandschaften mit extensiv bewirtschafteten Wiesen und Hochstamm-Obstbäumen. Ist in seinem Revier auf Hohlräume und Höhlen angewiesen, die er für die Tagesruhe, zum Brüten und im Winter auch zum Aufbewahren der Beute benutzt. Das ist der Steinkauz, mit wissenschaftlichem Namen Athene noctua.
Zur Jahrtausendwende fast ausgestorben
Jahrhundertelang lebte die kleine Eule in unmittelbarer Nachbarschaft des Menschen – ihre Rufe waren im Mittelland und im Jura in fast 1000 Obstgärten zu hören. Im letzten Jahrhundert verminderten sich die Bestände des Steinkauzes rapide. «In der Region sind die Bestände in den 1960er-Jahren regelrecht zusammengebrochen», weiss Adrian Wullschleger, Co-Präsident des Naturschutzvereins Vordemwald. Dafür gebe es zwei Hauptgründe, führt der begeisterte Ornithologe und Naturfotograf aus. Zum einen seien Tausende Hochstamm-Obstbäume gefällt worden, womit der Steinkauz seine Nistplätze verloren habe. Zum andern habe die Politik die Weichen in Richtung einer intensivierten, einseitig auf Ertrag ausgerichteten Landwirtschaft gestellt, die dem Steinkauz durch den Einsatz von Pestiziden und durch Überdüngung vielerorts die Nahrungsgrundlage geraubt habe.
Vor 20 Jahren war der absolute Tiefpunkt erreicht. In der Schweiz wurden noch etwa 50 bis 60 Steinkauz-Paare gezählt. Die kleine Eule kam auf die rote Liste der stark gefährdeten Arten und stand kurz davor, als Brutvogel in der Schweiz auszusterben. Die Kehrtwende kam mit aufwendigen Artenförderungsprogrammen von Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife Schweiz und weiterer Partnerorganisationen. 2014 konnten bereits 121 Reviere verzeichnet werden, 2020 waren es schon 149. Steinkäuze leben in der Schweiz momentan in den Eichenhainen des Kantons Genf, den Hochstamm-Obstgärten der Ajoie im Kanton Jura, den Tieflagen des Tessins und im Berner Seeland. Weitere grössere Populationen gibt es in den grenznahen Gebieten der Nordwestschweiz.
Nun hat BirdLife Schweiz den Steinkauz zum Vogel des Jahres 2021 gekürt. Denn die kleine Eule steht wie kaum ein anderer Vogel für den Erfolg von Schutzmassnahmen, gleichzeitig auch für den mangelnden Einbezug der Biodiversität bei der Raumplanung. Mit der Auszeichnung will BirdLife Schweiz auch aufzeigen, dass es langfristig zwingend eine ökologischere Landwirtschaftspolitik und eine bessere Raumplanung braucht, um den Fortbestand des Vogels des Jahres, aber auch weiterer Arten im Kulturland zu sichern.

Ist der Steinkauz also über dem Berg? Und können wir seine Rufe bald auch wieder in der Region hören? «Fakt ist, dass im März dieses Jahres ein Steinkauz in Vordemwald aufgetaucht ist», sagt Adrian Wullschleger, und zwar auf dem Hirschmattenhof seines Bruders Ueli auf Oberbenzligen, wo auch eine Schleiereule überwintert hat und es zwei Turmfalken-Bruten gab. «Das war wahrscheinlich ein Steinkauz, der auf Reviersuche war», vermutet Adrian Wullschleger, der aber dann weitergezogen sei.
Die an sich erfreuliche Bestandesentwicklung dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem kleinen Kauz die Veränderungen der Landschaft in den letzten Jahrzehnten stark zugesetzt hätten, führt Adrian Wullschleger weiter aus. «Im Aargau ist der Steinkauz noch nicht wirklich angekommen», meint der 50-jährige Vordemwalder, aber viele ökologische Fördermassnahmen in der Landwirtschaft könnten sich diesbezüglich positiv auswirken. Die Möglichkeit, dass sich der Steinkauz in Zukunft das Mittelland und damit auch den Aargau wieder erschliessen werde, bestehe deshalb durchaus, meint Wullschleger. Ausbreiten könne er sich entweder vom Bielersee via Aaretal oder dann vom Schwarzwald her in Richtung Aargau. «Dem Steinkauz fehlen hier vor allem Deckungsangebote – bei uns ist es einfach zu aufgeräumt», sagt Wullschleger. Deshalb brauche es weitere ökologische Förderungsmassnahmen wie das Anlegen von attraktiven Biodiversitätsflächen und vor allem von Kleinstrukturen, wie Ast- und Steinhaufen oder von Trockenmauern, wenn man dem Steinkauz in der Region eine Chance geben wolle.
Fördermassnahmen will auch der Naturschutzverein Vordemwald erbringen. «Wir beabsichtigen, im Gemeindegebiet etwa 12 Nistkästen an geeigneten Stellen anzubringen», betont Wullschleger.
Hilfe auch für den Wiedehopf
Mit dem Anbringen von Nistkästen für den Steinkauz schlägt der Naturschutzverein Vordemwald quasi zwei Fliegen auf einen Streich. «Weil auch der Wiedehopf Nistkästen mit gleich grossen Einfluglöchern wie der Steinkauz benötigt, fördern wir damit auch diese Art», betont Adrian Wullschleger. In Vordemwald habe man in den letzten Jahren regelmässig rastende Wiedehopfe auf dem Frühlingszug feststellen können, 2016 sei ein Wiedehopf sogar zehn Tage hier geblieben, habe aber dennoch nicht hier gebrütet. Auch der Wiedehopf breitet sich in der Schweiz seit einigen Jahren wieder aus und dürfte von ähnlichen Fördermassnahmen wie der Steinkauz profitieren. «Wir sind noch nicht so weit, dass wir bei den beiden Arten schon bald mit Bruten rechnen können, aber mit der Schaffung geeigneter Lebensräume und Strukturen könnten sich die beiden Arten mittelfristig auch bei uns wieder ansiedeln», stellt Wullschleger abschliessend klar.