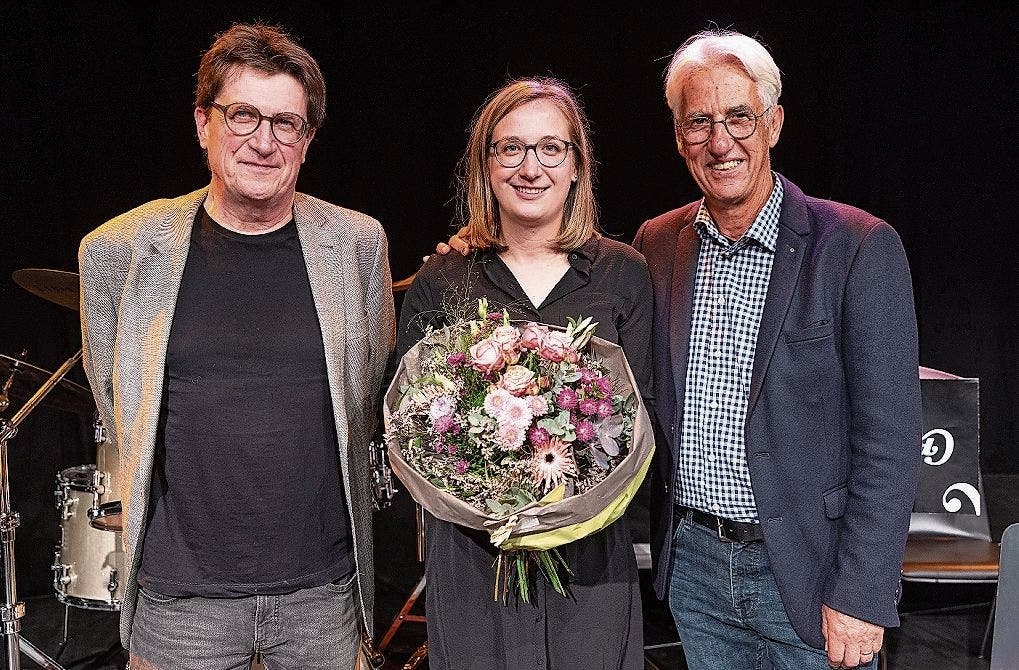Mit mehr Wissen in die zweiten Welle: Dank einer Studie lernt man viel über die Behandlung von Corona-Patienten
So viele Covid-19-Patienten wie in den vergangenen Tagen mussten die Spitäler im Kanton Solothurn noch nie behandeln. Am Mittwoch befanden sich 62 Personen im Spital, 14 davon auf der Intensivstation.
Bei der Pflege der Patientinnen und Patienten hilft den Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal aber das zusätzliche Wissen über die Versorgung von Erkrankten, das in den vergangenen Monaten zusammengetragen wurde. Unter anderem im Rahmen des «Solidarity Trials», einer Studie, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO durchführt.
Teil dieser Studie ist auch das Kantonsspital Olten. Für die Studie ist Matthias Hoffmann verantwortlich, er ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Infektiologie und Leitender Arzt der Abteilung für Infektiologie am Kantonsspital in Olten.
Mehr Wissen zu den einzelnen Therapien
«Wir haben in meinen Augen durch die Studienteilnahme sehr profitiert», schreibt Hoffmann anlässlich der ersten Zwischenbilanz, welche die WHO vor rund drei Wochen gezogen hat. «Wichtig ist, dass belastbare Resultate durch die Zusammenarbeit aller Zentren und Nationen generiert werden konnten, und wir mit dieser Studie nun zu Beginn der zweiten Welle klar mehr zu der Wirksamkeit einzelner medikamentöser Therapien wissen.»
Im Zwischenbericht kam die WHO zum Schluss, dass drei der vier untersuchten Therapieansätze nicht weiterverfolgt werden sollen. In Olten werden zwei der drei Medikamente schon seit dem Sommer nicht mehr eingesetzt, so Hoffmann, und eines sei gar nie eingesetzt worden.
Weiter untersucht werden soll im Rahmen der Studie in den nächsten Monaten aber die Wirkung des Medikaments Remdesivir. Zwar wirkt sich das Medikament laut den bisherigen Studienresultaten nicht auf die Sterblichkeit der Patienten aus, allerdings scheinen erste Resultate aus einer anderen Studie darauf hinzuweisen, dass sich Patienten, die mit Remdesivir behandelt wurden, von einer Erkrankung schneller erholen. Zwar konnte dieser Effekt in der Solidarity-Studie nicht nachgewiesen werden, mit Blick auf die Resultate der anderen Erhebung will die WHO den Effekt von Remdesivir im Rahmen der Solidarity-Studie aber weiter untersuchen.
Am Kantonsspital Olten haben laut Hoffmann bisher 14 Patientinnen und Patienten an der Studie teilgenommen, insgesamt wären über 50 Personen für eine Teilnahme am Projekt in Frage gekommen. Die Patienten in Olten werden alle gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie unter anderem mit dem Medikament Dexamethason behandelt, die Teilnehmer der Solidarity-Studie erhalten laut Hoffmann aktuell zusätzlich zu dieser Standardtherapie je nach Studienzuteilung das Medikament Remdesivir.
Zum Einsatz kommen diese Medikamente rund eine Woche, nachdem erkrankte Personen Symptome entwickelt haben. «In der ersten Phase der Erkrankung ist die Symptomatik primär durch die starke Virusvermehrung geprägt», erklärt Hoffmann. «Ab dem 7. bis 10. Tag tritt bei schweren Verläufen eine überschiessende Entzündungsreaktion auf. Remdesivir hemmt ein wenig die Virusvermehrung, Dexamethason dämpft die Entzündungsreaktion.»
Die Teilnahme an der Studie der WHO hat sich laut Hoffmann noch aus einem weiteren Grund bewährt: Das systematische Vorgehen innerhalb der Studie habe insgesamt zu einem einheitlichen Vorgehen bei der Erfassung des Krankheitszustandes und -verlaufs der Patienten geführt, was es dem Spital erleichtere, mit dem aktuell hohen Patientenaufkommen umzugehen.
Zusammenarbeit zwischen den Spitälern gefördert
Aufgrund der positiven Erfahrungen habe man sich dazu entschlossen, weiter an der Solidarity-Studie der WHO teilzunehmen. Es besteht laut Hoffmann die Möglichkeit, dass im Rahmen der Studie in den kommenden Monaten neue Medikamente getestet werden. «Dies sind dann teils Medikamente, die im Unterschied zu den Medikamenten zu Beginn der Studie spezifisch für die Behandlung von Covid-19 entwickelt wurden», erklärt der Infektiologe.
Wann diese neuen Medikamente eingesetzt werden können, sei zwar noch offen, so Hoffmann. Aber: «Es ist uns sehr wichtig und wir sehen es als einen Teil unserer Aufgabe in der Gesundheitsversorgung, dass wir dieselben therapeutischen Möglichkeiten wie ein Teil der Universitätsspitäler anbieten können.» Eine weitere Teilnahme an der Solidarity-Studie könnte laut Hoffmann allenfalls frühzeitig den Zugang zu diesen neuen Medikamenten ermöglichen.
Teil der gross angelegten Studie zu sein, ist laut dem Infektiologen ein nicht alltägliches Erlebnis. «Es ist spannend zu sehen, dass es möglich ist, in kurzer Zeit mit wenig Ressourcen eine ethisch und wissenschaftlich korrekt durchgeführte Studie aufzusetzen», schreibt er. «Und dass es zumindest in diesem Studiengedanken eine gelebte Solidarität unter den Menschen und Ärzten auf der ganzen Welt gibt.»
Weltweite Studie im Kampf gegen das Virus
Ziel der Solidarity-Studie der WHO ist es, möglichst schnell herauszufinden, mit welcher Therapie Covid-19-Patienten behandelt werden können. Zu Beginn der Studie im April wurden vier unterschiedliche Therapien gegen das Coronavirus miteinander verglichen. Getestet wurden das Medikament Remdesivir, das ursprünglich für den Kampf gegen Ebola entwickelt wurde, das Malariamedikament Chloroquin und zwei Kombinationen aus den Medikamenten Lopinavir und Ritonavir, die gegen HIV verabreicht werden, mit oder ohne Interferon, einem Botenstoff der Abwehrreaktion. Einzig die Therapie mit Remdesivir wird weiterverfolgt, wie die WHO in ihrem Zwischenbericht zu der Studie schreibt. An der Studie haben 405 Spitäler aus 30 Ländern teilgenommen. Über 11000 Patientinnen und Patienten wurden behandelt. Das Design der Studie ist bewusst einfach gehalten, wie die WHO schreibt. So soll laut der Organisation sichergestellt werden, dass die Spitäler durch die Teilnahme an der Studie nicht zusätzlich belastet werden. Das Personal in den Spitälern trägt die für die Studie relevante Daten der Patienten nach deren Einwilligung in die Datenbank ein und gibt an, welche Medikamente in dem jeweiligen Spital vorhanden sind. Daraufhin werden die Patienten nach dem Zufallsprinzip entweder mit einem Medikament aus der WHO-Studie oder mit der bisher in dem Spital angewendeten Therapie behandelt. (rba)