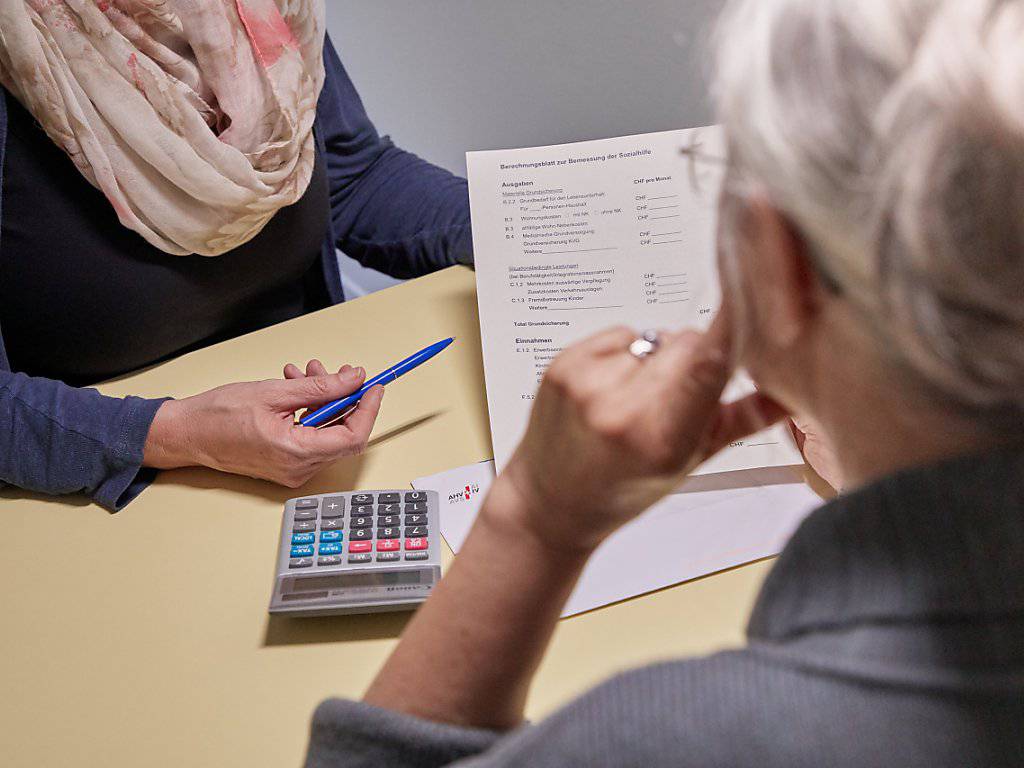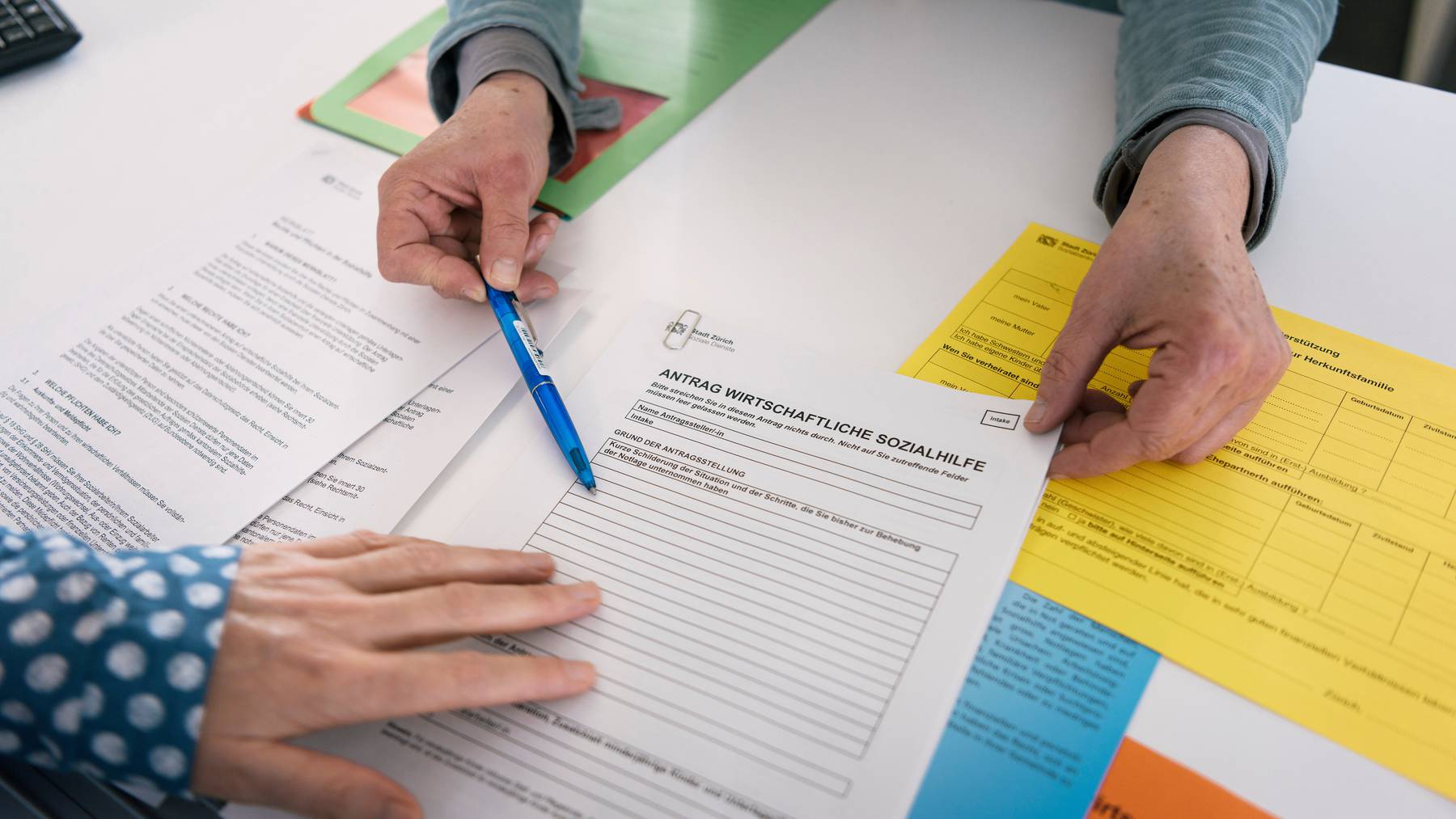An Sozialdetektiven schieden sich die Geister: Heute zeigt sich – sie kommen im Aargau kaum zum Einsatz
Die Gegner zeichneten düstere Szenarien. Detektive würden uns auf Schritt und Tritt verfolgen, mit Feldstechern in unsere Schlafzimmer spähen, ja gar Drohnen und Nachtsichtgeräte einsetzen. All das, um herauszufinden, ob der Unfall eines IV-Bezügers wirklich so schlimm war, wie er es darstellt. Ob er sich das Geld nicht mit falschen Angaben erschleichen würde.
2018 stimmten wir darüber ab, ob Sozialversicherungen wieder Detektive einsetzen dürfen. Der Abstimmungskampf wurde mit harten Bandagen geführt. Er hatte mehrere Beschwerden am Bundesgericht zur Folge. Mehrmals versuchte der Bundesrat, schlichtend in den Abstimmungskampf einzugreifen.
Es dürften weder Drohnen noch Nachtsichtgeräte eingesetzt werden, beschwichtigte er. Schlafzimmer seien tabu. Detektive würden nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden und sie würden eine Bewilligung brauchen. Sie seien ausserdem wichtig, um Betrüger zu entlarven. 80 Millionen Franken, jährlich und schweizweit, würden die Versicherungen dank ihnen sparen. Schliesslich setzten sich die Befürworter durch. Und zwar deutlich. Seit rund einem Jahr dürfen Sozialversicherungen wieder Detektive einsetzen. Nur: Im Aargau hat das seither kaum jemand getan.
Suva: Keinen Verdacht auf Missbrauch im Aargau
Dabei wäre es nicht so, dass Sozialdetektive ein komplett neues Mittel sind, dessen Umgang noch erlernt werden müsste. Bis 2016 waren Detektive erlaubt. Erst dann kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zum Schluss, dass es gar keine gesetzliche Grundlage für die Observationen gibt – was dann über Umwegen zur Abstimmung führte. Zuvor heuerte die Aargauer IV-Stelle etwa 20 Detektive jährlich an. Die grösste Unfallversicherung, die Suva, setzte um die 10 bis 15 Detektive jährlich ein, dies allerdings schweizweit.
Für den Einsatz ist ein Anfangsverdacht zwingend
Ganz anders jetzt, im ersten Jahr, seit sie es wieder dürften: Die Suva im Aargau setzt keine Sozialdetektive ein, die öffentliche Arbeitslosenkasse ebenso wenig und die SVA Aargau gerade mal zwei. Wieso nur so wenige? Spüren die Versicherungen die Nachwehen der emotionalen Abstimmung und verzichten lieber auf Detektive?
Bei der Suva ist dies, nach eigenen Angaben, nicht der Fall: «Generell setzt die Suva das Mittel der Observation sehr zurückhaltend und als letztes Mittel zur Abklärung kostenintensiver Fälle ein, in denen eine Rente geschuldet oder absehbar ist», teilt die Suva mit. Zudem brauche es für den Einsatz eines Detektivs zwingend einen Anfangsverdacht auf Versicherungsmissbrauch. Im Aargau habe es im vergangenen Jahr nun aber keinen solchen Fall mit einem Anfangsverdacht gegeben, entsprechend auch keine Observationen, so die Suva.
Neues Gesetz und Corona: Kaum Detektive bei der SVA
Noch weniger ein Thema sind Detektive bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse. Hier habe man noch gar nie Detektive eingesetzt, heisst es auf Anfrage. Wer Arbeitslosengeld bezieht, ist auch bei den RAV gemeldet. Durch diese Betreuung würden die Versicherten bereits gut genug kontrolliert, dass allfällige Missbräuche aufgedeckt würden. Zusätzliche Detektive seien nicht notwendig.
Bleibt noch die Aargauer Invalidenversicherung, die der SVA Aargau angehängt ist. Sie hat dieses Jahr zwei Detektive angeheuert. 2016 waren es noch zwanzig. Wieso nun so wenige? Die Zahlen könne man nicht miteinander vergleichen, teilt die SVA mit. Zum einen wegen Corona: Der Lockdown habe die Anzahl in Auftrag gegebenen Observationen beeinflusst. Und zum anderen: Das Gesetz ist neu. Man habe sich zuerst intern neu organisieren und abklären müssen, wie man genau damit umgehen möchte, so die SVA. Das brauche Zeit. Wie sich die Zahl der Observationen entwickeln werden, könne man noch nicht sagen.
80 Verdachtsfälle ohne Detektive abgeklärt
Auch die SVA betont: «Der Anteil jener Versicherten, die sich nicht korrekt verhalten, ist verschwindend gering.» Eine Observation sei immer das allerletzte Mittel. Es gebe andere Möglichkeiten, um Betrüger aufzuspüren. Etwa persönliche Befragungen oder eine Sichtung der ärztlichen Unterlagen. So habe die SVA 2019 knapp 80 Verdachtsfälle auf Missbrauch abklären können – ohne Detektive.