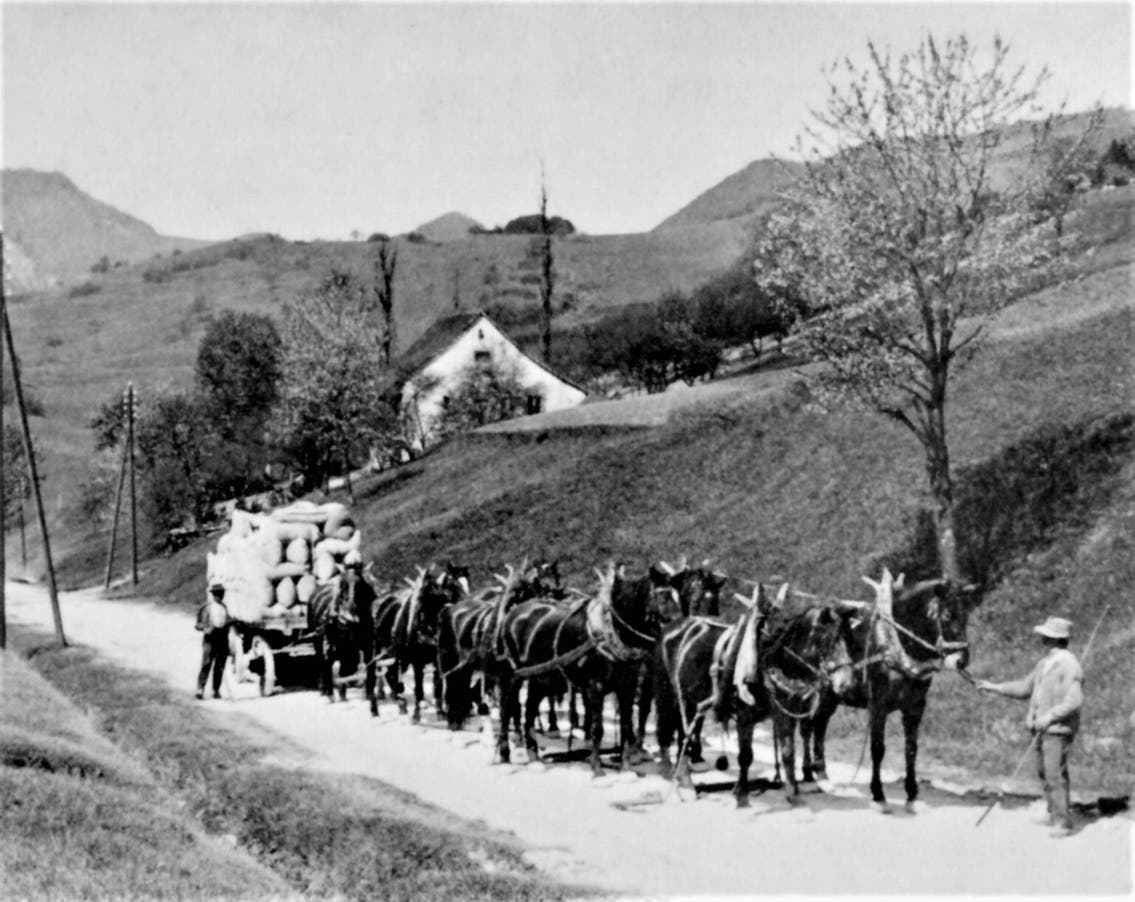Nur drei Bus- und zwei Zuglinien im Aargau rentieren: Die Übersicht über alle Strecken
Bisher war es ein gut gehütetes Geheimnis: Weder der Bund noch der Kanton noch die Transportunternehmen publizierten Zahlen zum Kostendeckungsgrad einzelner Bus- und Bahnlinien. Mit einem Gesuch nach dem Öffentlichkeitsgesetz hat der «Tages-Anzeiger» beim Bundesamt für Verkehr nun erstmals detaillierte Daten erhalten. Demnach rentieren von den schweizweit rund 1400 Verbindungen im öffentlichen Verkehr nur gerade 18. Alle anderen Linien weisen einen Deckungsgrad auf, der unter 100 Prozent liegt. Bei fast 500 Linien decken die Einnahmen aus Billettverkäufen laut der Zeitung nicht einmal 30 Prozent der Kosten.
Auch im Aargau ist der weitaus grösste Teil der Bus- und Bahnverbindungen nicht selbsttragend, wie eine Auswertung der AZ zeigt. Nur gerade 5 von insgesamt 134 Linien sind kostendeckend (siehe Tabellen). Landesweit prüft der Bund, der sich mit hohen Beträgen am öffentlichen Verkehr beteiligt, 33 Linien mit besonders schlechtem Deckungsgrad.
Darunter ist auch die Buslinie von Sins über Dietwil im Oberfreiamt nach Gisikon-Root LU, die einen Deckungsgrad von 18,4 Prozent aufweist. Doch warum prüft der Bund gerade diese Linie, und nicht auch die Verbindungen Magden–Olsberg–Giebenach im Fricktal, oder Koblenz–Full–Leibstadt im Zurzibiet, die noch schlechter abschneiden?
Das Bundesamt für Verkehr erwartet laut einem Sprecher bei allen Linien eine minimale Wirtschaftlichkeit. Bei Verbindungen in sehr ländlichen Gebieten soll der Deckungsgrad mindestens zehn Prozent betragen, bei den übrigen Angeboten 20 Prozent. Das Bundesamt hat eine Liste mit Linien erstellt, die überprüft werden, weil sie die Kriterien nicht erfüllen – darunter fällt die Linie im Oberfreiamt. Eine Möglichkeit wäre, dass die Busse auf dieser Strecke weniger häufig verkehrten. Die härteste Massnahme wäre der Ausstieg des Bundes aus der Finanzierung der Linie. Dann müssten die Kantone und betroffenen Gemeinden die Kosten übernehmen – oder die Linie streichen.
Kanton sieht keinen Anlass, die unrentable Linie zu streichen
Jürg Bitterli, Projektleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton, sagt auf Anfrage: «Das ist eine typische Schülerverbindung, die je nach Wetter sehr unterschiedliche Passagierfrequenzen aufweist. Wenn es schön ist und viele Jugendliche mit dem Velo in die Schule fahren, sind die Auslastung der Busse und der Kostendeckungsgrad niedriger, bei schlechtem Wetter und vielen Passagieren ist es umgekehrt.» Für den Kanton Aargau sei dies kein Grund, die Finanzierung einer solchen Buslinie einzustellen, hält Bitterli fest.
Wenn der Bund die Kostendeckung einzelner Linien veröffentliche, sei das im Sinn der Öffentlichkeit okay, findet Bitterli. «Dieser Wert allein sagt aber nicht viel aus, bei vielen Linien braucht es zusätzliche Erklärungen», warnt er. So sei der Deckungsgrad zum Beispiel schlecht, wenn ein Zug in Randzeiten am Endbahnhof lange stehe, auf einer Linie ein grosser Gelenkbus zum Einsatz komme, weil bei gewissen Kursen viele Schüler befördert werden müssten, oder bei einer Verbindung ein Teil als Fernverkehr abgerechnet werde.
Zu den rentabelsten Angeboten im Aargau zählen fünf Nachtbuslinien ab Baden. «Das ist so, weil die Busse für den Einsatz tagsüber schon zur Verfügung stehen – wenn sie nur in der Nacht eingesetzt würden, also die Fahrzeugkosten separat gerechnet werden müssten, läge der Kostendeckungsgrad deutlich tiefer», sagt Bitterli. Zudem werde sich der Deckungsgrad verändern, wenn der heute geltende Nachtzuschlag von 5 Franken wegfallen sollte.
Aargau kennt keinen minimalen Deckungsgrad für ÖV-Linien
In gewissen Kantonen – wie in Luzern mit 20 Prozent – gibt es einen minimalen Deckungsgrad, damit eine Linie mitfinanziert wird. «Bei uns im Aargau gibt es keine solchen Vorgaben, wir sind bis zu einem gewissen Grad flexibel und halten uns an interne Richtlinien im Departement», sagt Jürg Bitterli. Kriterien seien Passagierzahlen, Deckungsgrad, aber auch regionale Aspekte, gerade für Verbindungen im ländlichen Raum.
Seit zwei Jahren zahlen die Gemeinden nichts mehr an den öffentlichen Verkehr, die Kosten trägt vollständig der Kanton. «Wir haben damit gerechnet, dass viele Gemeinden deshalb Anträge für neue Linien stellen würden, dies hält sich aber im Rahmen», sagt Bitterli. Wenn eine Gemeinde eine neue Linie möchte, kann sie einen dreijährigen Versuchsbetrieb selber zahlen. Wenn danach gewisse Werte bei Kostendeckung und Passagierzahlen erreicht werden, übernimmt der Kanton die Kosten und die Linie wird definitiv.