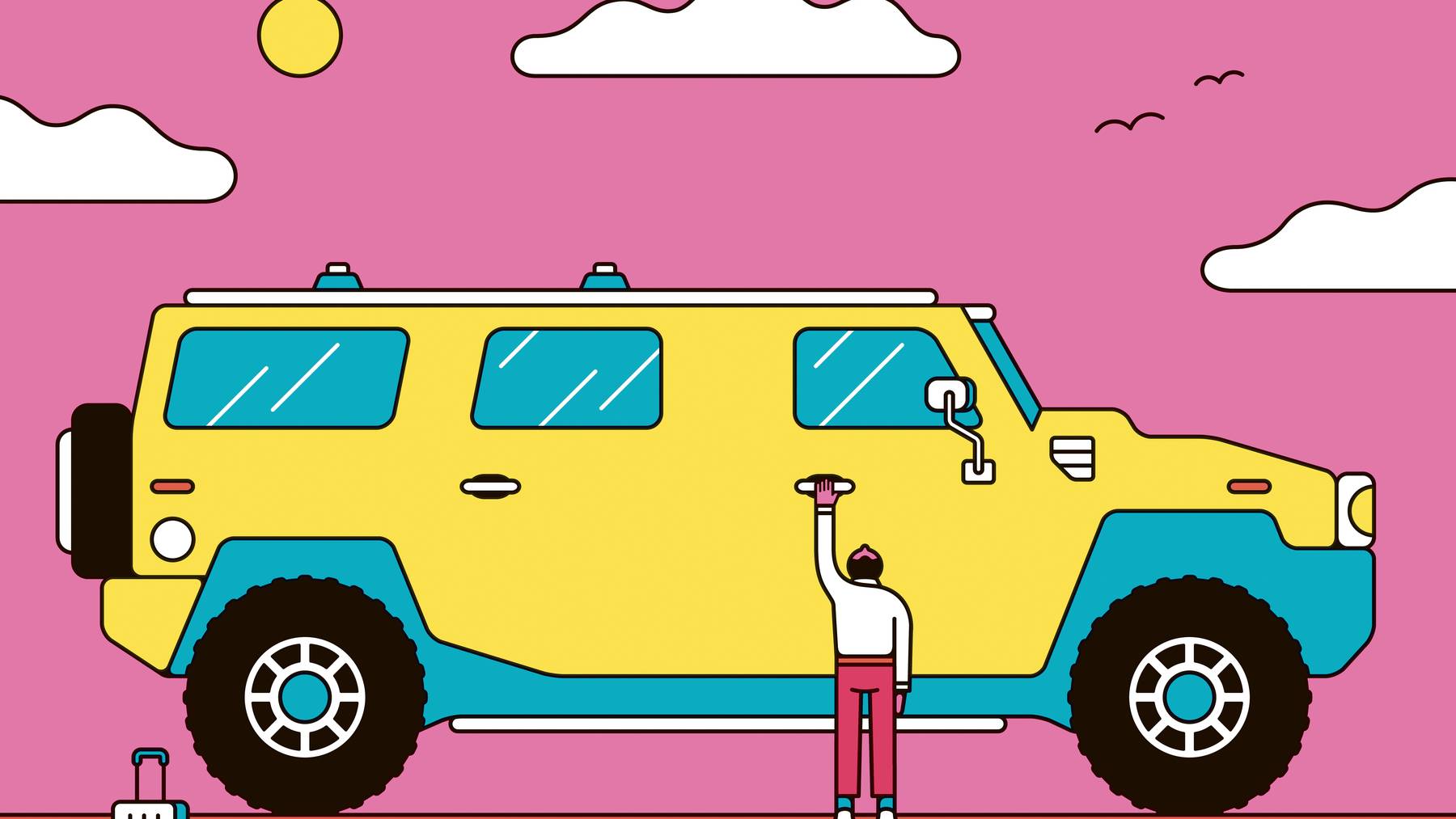Klimaforscher Reto Knutti zur Weltklimakonferenz: «Die Zeit läuft uns davon»

Die Verhandlungen in Madrid sind zäh verlaufen. Vor allem wegen der Emissionszertifikate, die auch die Schweiz betreffen. Was war da genau das Problem?
Reto Knutti: Der Emissionshandel ist ein Versuch, das Geld für den Klimaschutz möglichst wirtschaftlich einzusetzen. Und dort Emissionen zu reduzieren, wo es am günstigsten ist. Denn jeder Markt braucht Spielregeln.
Und wie lauten die?
Die Länder müssen die Zusätzlichkeit nachweisen. Sicherstellen, dass eine Massnahme im Ausland nicht sowieso aus wirtschaftlichen Gründen umgesetzt worden wäre, sonder für den Klimaschutz. Eine Reduktion kann nicht gleichzeitig dem Land angerechnet werden, das bezahlt, und demjenigen das sie ausführt. Man muss auch sicherstellen, dass es für ein Land nicht zu attraktiv wird, seine CO2 Reduktionen dem Ausland zu verkaufen, und damit Geld zu verdienen, statt sie als Teil des eigenen Beitrags zur Lösung des Klimaproblems zu deklarieren.
Hat denn dieser Markt schon mal funktioniert?
Aus früheren Zeiten gibt es zu viele dieser Zertifikate und der Markt funktioniert nicht, weil sie fast nichts kosten. Das Zahl, diese Marktmechanismen in Madrid neu zu verhandeln, ist vorerst gescheitert.
Was sind die Folgen für die Schweiz?
Die Schweiz will 40 Prozent der CO2-Reduktion durch Auslandkompensation erreichen. Heute wurde vom Bafu erklärt, dass sich die Schweiz nun freiwillig zu ambitionierten Marktregeln verpflichten will, was positiv ist. Bald wird sie viel teuer sein, und ab 2050 gibt es sie nicht mehr, wenn dann alle Länder bei Null Treibhausgas-Emissionen sein müssen.
Was bedeutet das?
Dann bezahlen Länder wie die Schweiz doppelt. Zuerst heute für die Kompensation im Ausland und später für den Umbau der eigenen Infrastruktur. Wenn man neben den Kosten für die Vermeidung von CO2 auch den volkswirtschaftlichen Nutzen im eigenen Land durch Innovation, Arbeitsplätze und bessere Lebensqualität berücksichtigt, wäre es langfristig günstiger mehr im Inland zu tun.
Über diese Zertifikate wurde heftig gestritten in Madrid. Waren denn die einzelnen Klimaziele der Länder gar kein oder kaum ein Thema?
Der Fahrplan des Pariser Abkommens sieht vor, dass die Länder bis 2020 ihre individuellen Ziele neu deklarieren. Man hat daher in Madrid nicht konkrete Zahlen erwartet, aber eine Einigung auf den Fahrplan für das nächste Jahr. Und das nächste Jahr ist für die Wirksamkeit des Pariser Abkommens kritisch.
Die grössten Emittenten haben gar keine Anzeichen gemacht, ihre Klimaschutzziele zu verstärken. Ist es realistisch, dass alle Länder im nächsten Jahr ihre Ziele erhöhen?
Das ist im Moment schwierig zu beurteilen. Die EU wie einzelne europäische Staaten haben in den letzten Monaten ambitionierte Ziele angekündigt. China war an der Klimakonferenz zurückhaltend, und Brasilien, die USA und Australien haben den Prozess regelrecht blockiert. Aus der Sicht der Klimaverhandlungen scheint Madrid ein Tiefpunkt zu sein, andererseits war das Thema mit den Klimastreiks noch nie so präsent wie dieses Jahr. Vielleicht muss der Umschwung und Druck von unten kommen. Aber ein starkes internationales Bekenntnis der Staaten zum Klimaschutz wäre wichtig.
Entwicklungsländer wollen, dass die Industrieländer mehr an die Klimaschäden beitragen. Da hat es anscheinend keine Verbesserung gegeben. Ist diese Forderung der betroffenen «Klimaländer» überhaupt gerechtfertigt?
Tatsache ist, dass die westliche Welt, China, Indien, und Brasilien von der günstigen fossilen Energie über Jahrzehnte extrem profitiert, aber damit ein globales Problem geschaffen haben, unter dem vor allem die Entwicklungsländer leiden. Diese sind dem Klimawandel stark ausgesetzt. Zum Beispiel mit einen hohen Anteil an Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Sie haben weder das Geld noch Technologien, um sich gegen die Folgen der Erderwärmung zu wehren. Damit ist es nichts als fair, dass wir ihnen helfen müssen. Einerseits um ihre Risiken zu vermindern, und andererseits damit sie von Anfang an auf saubere Energieträger setzen.
Was wäre denn faire Hilfe?
Alleine können ärmere Länder das nicht stemmen. Was aber genau eine faire Hilfe ist, das lässt sich nicht mathematisch beweisen. Das ist Verhandlungssache, wer wie viel dazu beitragen muss.
Die EU will 2020 ein umfassendes Klimaschutzprogramm umsetzen, van der Leyen spricht vom Green Plan. In Europa gibt es Länder gibt es fortschrittliche Länder im Norden. Ist die EU auf gutem Weg?
Die EU ist im Vergleich zum Rest der Welt im Moment das Zugpferd. Diverse Länder haben das Netto Null CO2-Ziel verabschiedet oder diskutieren es. Die EU will die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren und die ganze EU bis 2050 klimaneutral machen. Das neue Programm macht Vorschläge in den Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Finanzierung und Handelspolitik. Die konkrete Umsetzung und Gesetzgebung wird aber nicht einfach werden.
Wie steht die Schweiz dazu im Verhältnis?
Die Schweiz hat zahlenmässig ähnliche Ziele, will aber bis 2030 nur 30 Prozent im Inland reduzieren und 20 Prozent im Ausland kompensieren. Für 2050 gibt es eine Netto Null Absichtserklärung des Bundesrates, aber die Ausarbeitung der Massnahmen beginnt erst. Es gibt viele offene Fragen, von der Technologie zu den Kosten bis zu den Massnahmen in den einzelnen Sektoren. Auch zur sozialen Verträglichkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist wichtig diese langfristigen Ziele zu diskutieren, aber sie dürfen uns nicht davon ablenken, jetzt Massnahmen zu ergreifen. Und das umzusetzen war wir schon können. Die laufende Revision des CO2-Gesetzes ist der erste Schritt, aber er wird nicht ausreichen. Es braucht mehr, und die Zeit läuft uns davon.