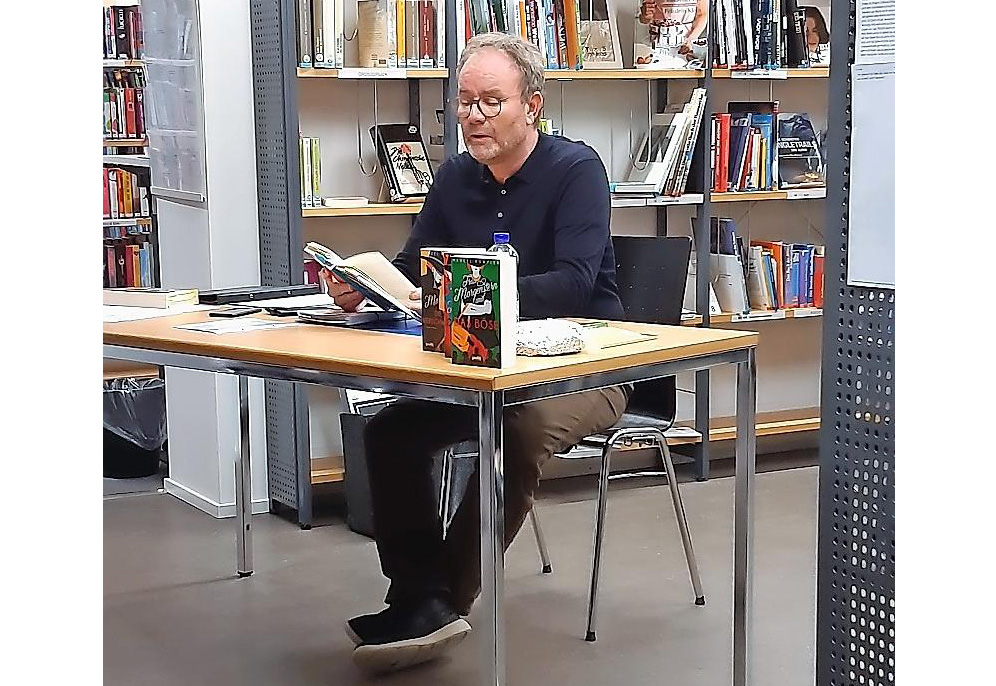Elterncoaching: Schule und Eltern im selben Boot unterwegs
Karin ist unkonzentriert, macht im Schulunterricht nicht mit, fällt durch Ungehorsam, Wutausbrüche, dem Missachten von Regeln und unerledigten Hausaufgaben immer wieder auf. Die Lehrperson sucht – wie später die Schulsozialarbeit – wiederholt mit der Schülerin das Gespräch. Eine merkliche Verbesserung bleibt jedoch aus. Auch die Unterhaltung mit den Eltern bringt nicht den gewünschten Erfolg. Das mögliche Beispiel ist kein Einzelfall. «Es ist nicht die Regel, aber es gibt immer wieder vereinzelte Kinder und Jugendliche, die den Unterricht stören», sagt Jürg Kalberer, Co-Schulleiter in Rothrist.
Wenn Gespräche, Zurechtweisungen, Ermahnungen und Strafaufgaben wirkungslos bleiben, setzt die Schule Rothrist auf das Elterncoaching. Seit fünf Jahren gibt es dieses niederschwellige Angebot. Im Zentrum steht, die Eltern für die Zusammenarbeit mit ihrem Kind und der Lehrperson zu gewinnen. «Es ist eine ideale Möglichkeit, etwas in Gang zu bringen, bevor es weitere Massnahmen im gesetzlichen Rahmen braucht», betont Co-Schulleiter Barbara Scheuzger und fährt fort: «Das Coaching holt die Eltern mit ins Boot und füllt eine Lücke im System.» Verglichen mit Angeboten – von der Schulsozialarbeit über den Schulpsychologischen Dienst bis zur Regionalen Beratungsstelle für Jugend-, Familie, Ehe- und Partnerschaft – binde es rasch und niederschwellig alle Beteiligten ein.
Kurzfristig umsetzbar und finanziell tragbar
Einen weiteren Vorteil gegenüber Familienarbeit oder einer sozialpädagogischen Familienbegleitung sehen die Co-Schulleiter darin, dass das Coaching kurzfristig umsetzbar, überblickbar und finanziell tragbar ist. «Soweit wir informiert sind, sind wir im Kanton Aargau bislang die erste Schule, die dieses Angebot in dieser Form anbietet», sagen Barbara Scheuzger und Jürg Kalberer. Maximal 25 Stunden stehen dem Elterncoach zur Verfügung, um mit den Eltern und wenn nötig dem Schüler oder der Lehrperson zu arbeiten. Auftraggeber ist die Co-Schulleitung. Voraussetzung sei, dass die Klassenlehrperson, die Stufenschulleitung und die Schulsozialarbeit sich einig seien, den Coach miteinzubeziehen. «Die Eltern müssen selbstverständlich bereit sein mitzuarbeiten», betonen Barbara Scheuzger und Jürg Kalberer.
Sind alle einverstanden, ist Jolanda Henzmann gefragt. Die Mühlethalerin ist seit bald zwanzig Jahren als Erziehungscoach und Familienbegleiterin tätig. «Ziel ist das Dreiersystem aus Eltern, Kind und Lehrperson zu verbinden», sagt sie und fährt fort. «Eltern und Lehrpersonen wollen, dass das Kind glücklich ist und eine erfolgreiche Schulzeit hat.» Die Fachfrau und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen setzt auf das «Kess erziehen»-Konzept von Alfred Adler und Rudolf Dreikurs «Kess steht für kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert», erklärt Jolanda Henzmann die Pfeiler. Diese basieren darauf, die Beziehung zu sich und zu anderen zu stärken, respektvoll miteinander umzugehen, die Selbstverantwortung des Kindes zu fördern und störendes Verhalten besser zu verstehen. «Dann können Eltern, aber auch Lehrpersonen, gelassener reagieren und Konflikte kreativ entschärfen», sagt sie und betont, die Notwendigkeit Grenzen zu setzen.
Kinder und ihre Probleme ernst nehmen
Ziel des Coachings sei, dem Kind und den Erwachsenen neue Strategien aufzuzeigen. Anstatt das Kind zu strafen und es vor die Tür zu schicken, sei wichtig herauszufinden, weshalb es den Unterricht störe. Was hinter dem Lügen, dem übermässigen Medienkonsum oder der Zerstörung von fremdem Eigentum stecke. Und weshalb es sich verweigere. «Es gibt es Situationen in denen auch das Coaching nicht weiterkommt», gesteht Barbara Scheuzger ein. Jürg Kalberer gibt aber zu bedenken: «Das Coaching hat das Ziel, weitere Kosten für die öffentliche Hand zu vermeiden und wird aus dem Pool der ‹Zusatzlektionen für Schulen mit erheblicher sozialen Belastung› finanziert.» Wie die Co-Schulleiter feststellen, ist die Nachfrage steigend. Im Schuljahr 2018/2019 waren es 30 Situationen. «Manchmal reichte eine Kurzberatung, in anderen Situationen brauchte es mehr Stunden», sagt Barbara Scheuzger. Sie und Jürg Kalberer sind mit der Schulpflege einig, dass das Elterncoaching hilfreich und zielführend ist, weil Veränderungen im Familiensystem Unterstützung von aussen brauchen. Die Gespräche finden im selben Haus der Schulsozialarbeit statt. Diese sei in den meisten Fällen ebenfalls involviert und Eltern seien so nicht ausgestellt.
«Eine der wichtigsten Erkenntnisse für ein gelingendes Miteinander, ist die Ermutigung», sagt Jolanda Henzmann. Es gehe bei Kindern und Erwachsenen darum, sie in ihren Stärken und Kompetenzen zu unterstützen. In den Gesprächen sei zentral, die Kinder mit ihren Problemen ernst zu nehmen. Nur so gewinne man sie für Lösungen und stärke ihr Selbstbewusstsein. «Zudem lernen sie so Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen», sagt Elterncoach Jolanda Henzmann und betont: «Erziehung ist Beziehung, und jedes Kind braucht das Gefühl der Zugehörigkeit.»