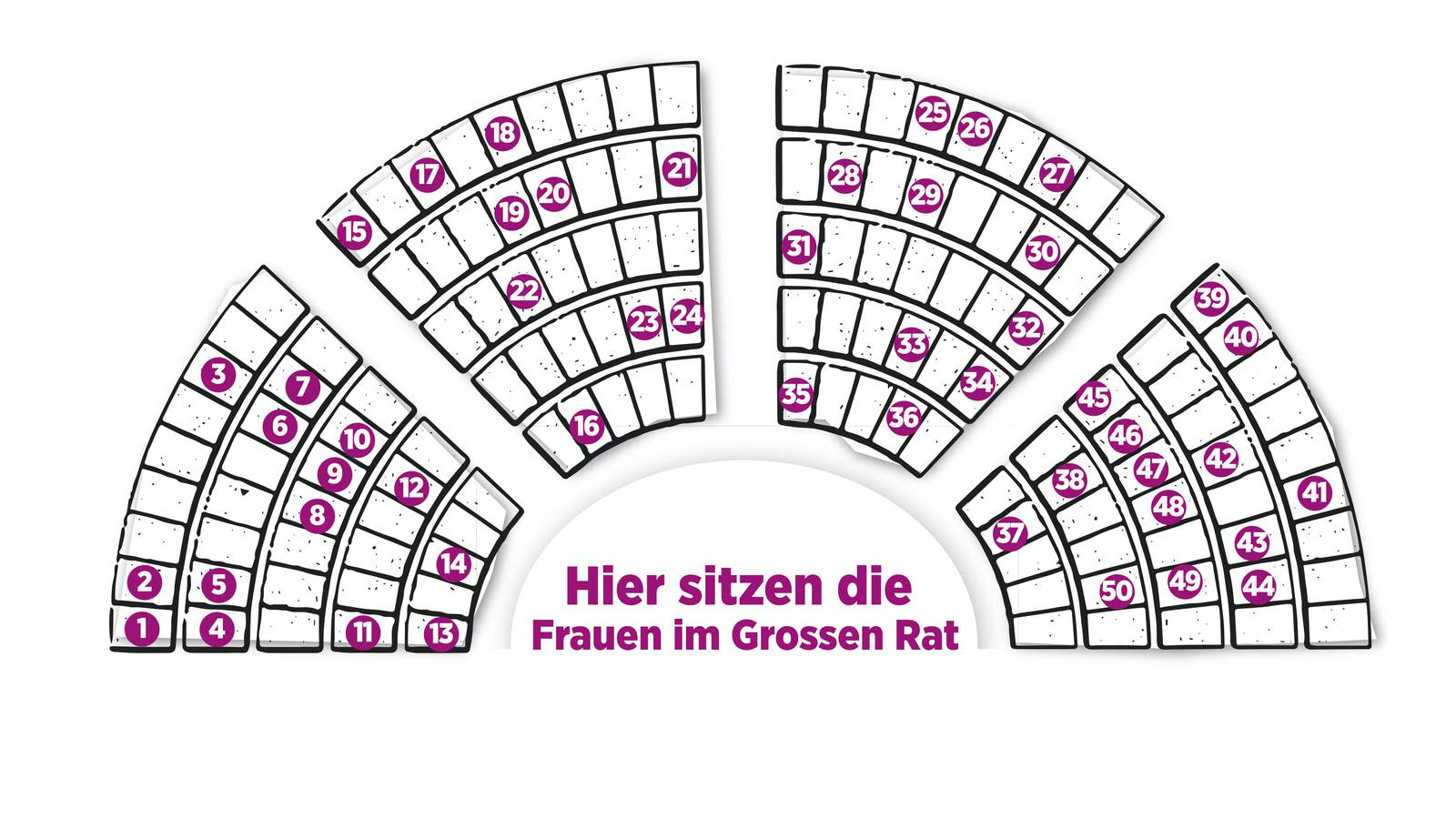«Bezahlt endlich die Mütter» – warum ein Hausfrauenlohn das Dilemma Job und Familie lösen hilft
Zur Person
Gehen Sie am Freitag auf die Strasse für den Frauenstreik?
Sybille Stillhart: Aber sicher doch, das ist gar keine Frage. Frauen müssen ihre Forderungen sichtbar machen. Ich nehme an einer Kinderwagendemonstration in Bern teil.
Und was wird auf Ihrem Transparent stehen?
Ich fordere einen einjährigen Mutterschaftsurlaub.
Erinnern Sie sich noch an den ersten Frauenstreik 1991?
Ja, wir Schülerinnen «streikten» damals an der Kanti St. Gallen und besuchten in der Aula eine Podiumsdiskussion. Viel war da von «Unabhängigkeit» die Rede und davon, dass Frauen genauso einen Beruf erlernen sollten wie Männer. Ganz bestimmt wollten wir keine Hausfrauen wie unsere Mütter werden und für unsere Männer kochen und putzen. Eine gute Ausbildung würde uns zu einem emanzipierten Leben führen. Dessen waren wir uns sicher.
Und haben sich Ihre Vorstellungen 28 Jahre später verwirklicht?
Ich habe eine gute Ausbildung genossen, einen guten Job bekommen, auch mit zwei Kindern weitergearbeitet. Doch glücklich gemacht hat es mich nicht. Es fühlt sich nicht emanzipiert an, von der Krippe zur Arbeit zu hetzen, dort mit einem schlechten Gewissen seine Zeit abzusitzen, um dann um sechs Uhr auf den letzten Drücker die Kinder wieder abzuholen und am Abend den ganzen Haushalt zu schmeissen.
Hat in Ihren Augen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Frauen nichts gebracht ausser Stress?
Genau, Vereinbarkeit bedeutet heute, dass eine Frau weiterarbeitet und gleichzeitig Hauptverantwortliche ist für Kinderbetreuung und Haushalt. Weil Kinderbetreuung und Haushalt nicht als «Arbeit» gelten, verdienen Frauen zu Hause nichts. Was konkret heisst: Frauen mit kleinen Kindern arbeiten 58 Stunden die Woche für ihren Haushalt und den Nachwuchs. Gehen sie zusätzlich einer Erwerbsarbeit nach – im Durchschnitt 14 Stunden –, kommen sie auf eine atemberaubende 72-Stunden-Woche. Bezahlt davon sind lediglich die 14 Stunden Erwerbsarbeit.
Auch wenn es sich die meisten Frauen bestimmt so gewünscht haben: Die Männer haben nicht die Hälfte aller Haus- und Erziehungsarbeit übernommen. Neun von zehn Vätern arbeiten weiter Vollzeit. Das Bundesamt für Statistik hält fest, dass bei gut drei Vierteln aller Familien die Frauen die Hauptverantwortung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung tragen – trotz Erwerbsarbeit, ja sogar dann, wenn sie 100 Prozent arbeiten.
Warum tun sich die Männer da so schwer, und warum setzen die Frauen zu Hause nicht mehr Druck auf?
Vielleicht sollten wir davon wegkommen, Väter oder Mütter zu «ändern», damit sie für das Erwerbsleben fit bleiben. Nehmen wir doch einmal die Arbeitswelt etwas genauer unter die Lupe. Es liegt doch auf der Hand: Je kürzer der Arbeitstag, desto besser lässt er sich mit einer Familie vereinbaren. In Dänemark etwa gibt es die 33-Stunden-Woche.
Wenn Sie sagen, dass die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie für die Frauen eine Mogelpackung sei, meinen Sie dann, die Frauen sollten besser wieder zu Hause bleiben?
Nein, viele können das auch gar nicht mehr, weil in der Schweiz längerfristig ein Lohn nicht mehr ausreicht, um eine mittelständische Familie zu ernähren. Die Wirtschaft hat längst erkannt, dass sie nun für einen «Ernährerlohn» zwei Arbeitskräfte bekommt, eine davon, die Frau, erst noch zu einem Dumpingpreis.
Ist der eigentliche Profiteur der beruflichen Emanzipation der Frau die Wirtschaft?
Ja, Profiteur und Treiber dieser Entwicklung ist die Wirtschaft. Ohne einen Finger zu krümmen, konnten Arbeitgeber ihr Arsenal an Arbeitskräften mit hoch motivierten Frauen verdoppeln. Doch die Strukturen der Arbeitswelt blieben so starr wie eh und je. Das mag so lange aufgehen, bis ein Kind auf die Welt kommt. Danach drehen die Frauen am Rad, kommen aber nicht mehr vorwärts.
Wie müssten sich die Strukturen denn ändern?
Ich sehe das Hauptproblem nicht darin, dass es zu wenig Krippenplätze gibt oder Tagesschulen. Das Problem liegt viel tiefer. Es wird generell zu wenig über Mutterschaft nachgedacht. Wie viel Zeit braucht es, ein Kind grosszuziehen! Welche Anstrengung das erfordert! Was Mütter leisten, braucht Anerkennung. Und in einer kapitalistischen Welt läuft Anerkennung über Lohn. In allen Industrieländern geht vergessen, dass exakt die unbezahlten Arbeiten, das Kümmern um Kinder und pflegebedürftige Menschen, für eine Gesellschaft unverzichtbar sind.
Ganz konkret fordern Sie einen Hausfrauenlohn?
Ja, das klingt nur im ersten Moment abwegig. Es kann nicht sein, dass es – pointiert formuliert – mehr geschätzt wird, wenn Menschen Waffen herstellen und damit Geld verdienen und Frauen dafür bestraft werden, dass sie Kinder gebären und sich um sie kümmern. Schon in den 70er-Jahren forderten feministische Gruppen die Einführung eines Hausfrauenlohns.
Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Frauen werden angehalten, erwerbstätig zu bleiben.
Weil das für die Wirtschaft und den Staat billiger ist. Die Leidtragenden sind aber doch wieder die Frauen. Sie verfügen, sobald sie Mütter werden, über weniger Einkommen. Das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Warum wehren sich nicht mehr Frauen dagegen? Sie selber stehen mit diesen Forderungen doch ziemlich alleine da?
Weil den Frauen eingeimpft wurde, dass ihre Arbeit zu Hause mit den Kindern, mit alten Menschen nichts wert ist. Es ist ihr selbst gewähltes Schicksal. Aber ohne die Gratisarbeit, die Frauen leisten, würde nichts mehr gehen, würde die Gesellschaft zusammenbrechen.
Dann wäre es an der Zeit für einen Hausfrauenstreik?
Ja, weil dort der wahre Hund begraben liegt. Unsere Gesellschaft missachtet, was Frauen ausmacht, hält an Strukturen fest, die Frauen kleinhalten. Die Boni der Banker, die Dividenden der Grosskonzerne – sie sind das Geld, das Frauen zur Verfügung gestellt werden müsste. Zudem hätte die Bezahlung der Hausarbeit auch für Väter Vorteile: Sie könnten selbstbewusster fordern, Teilzeit zu arbeiten, und wären davon befreit, die finanzielle Hauptlast zu tragen. Familien verfügten plötzlich über das, was ihnen heute am meisten fehlt: Zeit und Geld.