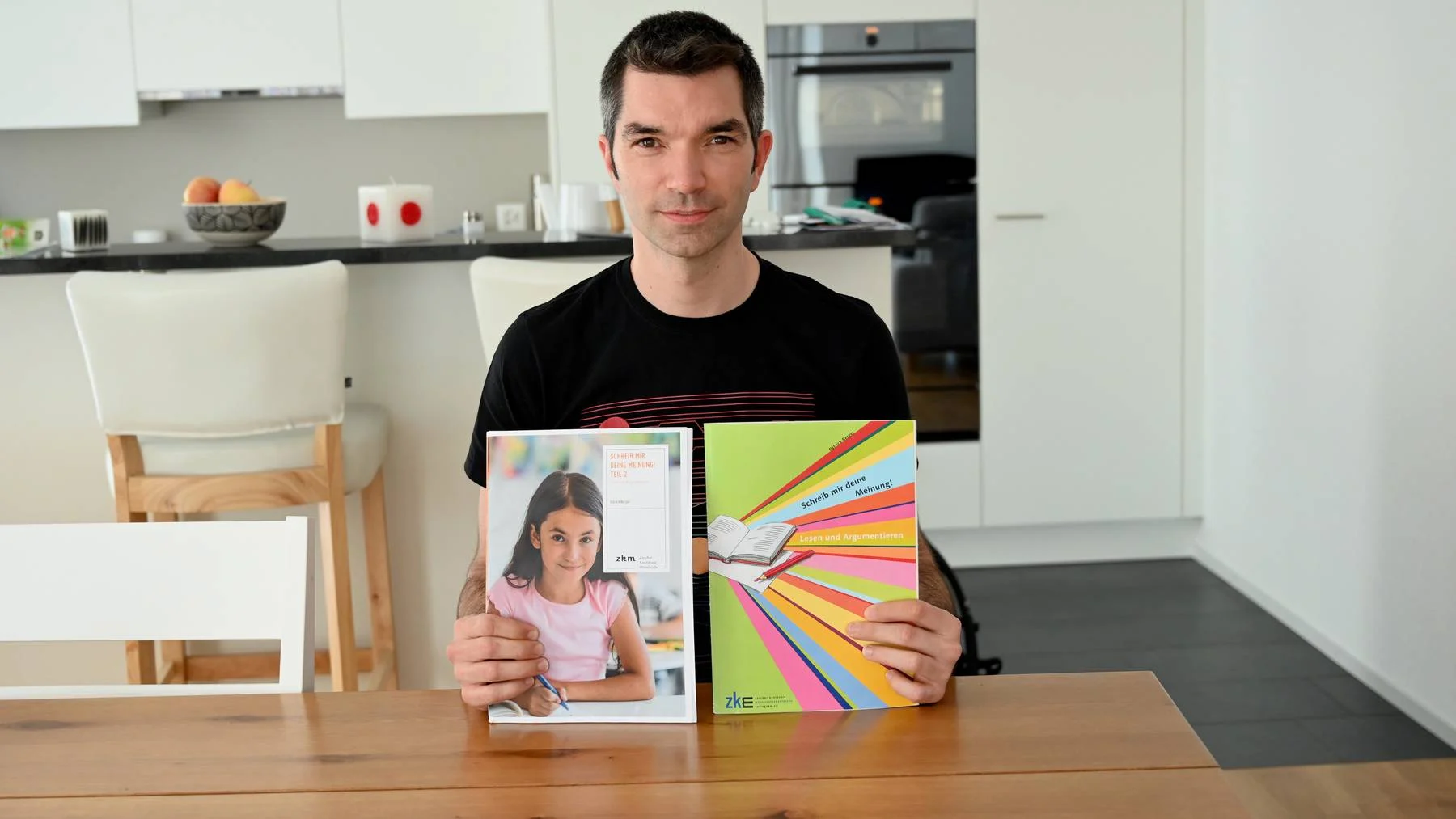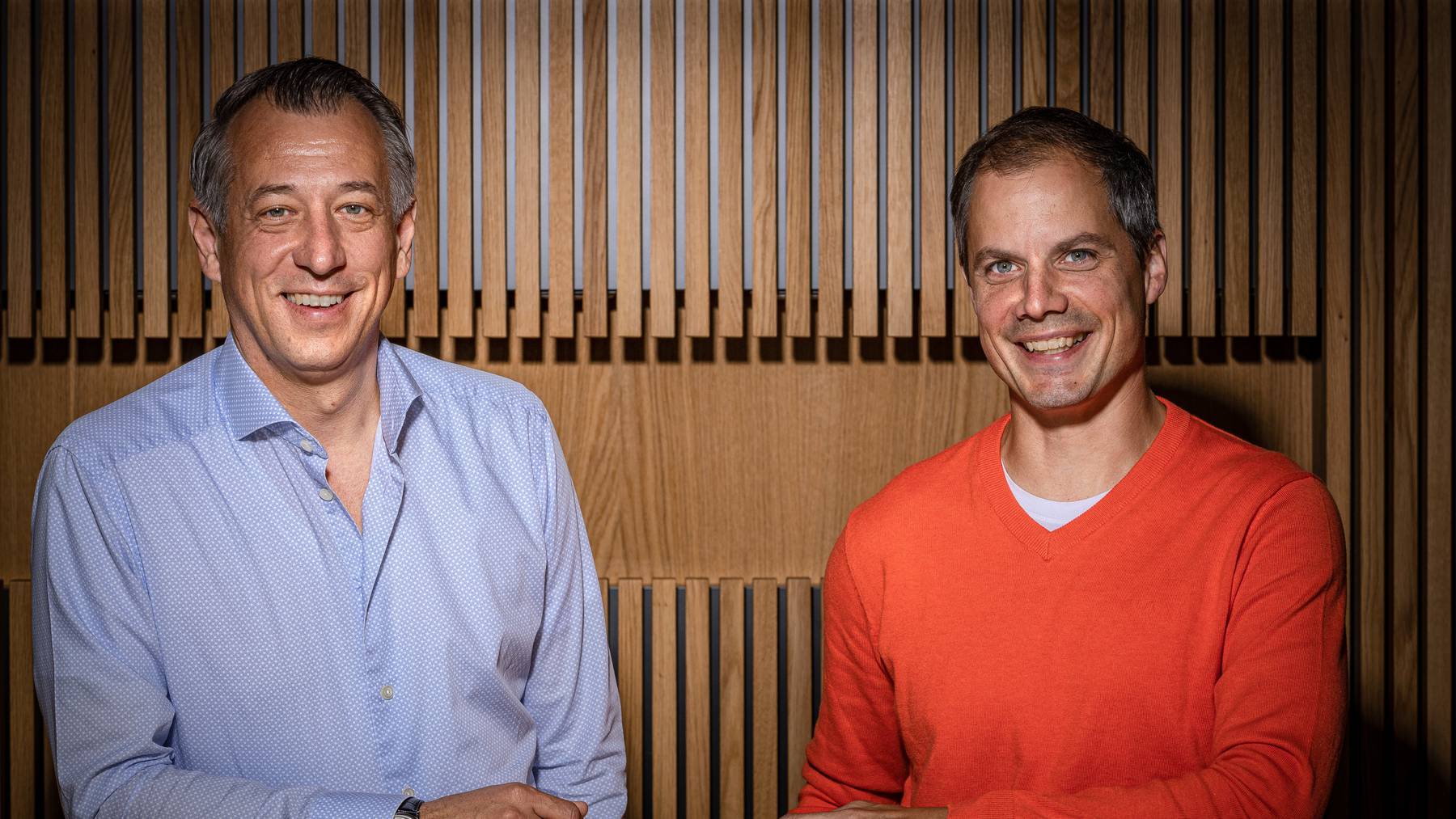Aargauer Sonderschulen am Anschlag – jedes Jahr müssen Kinder abgewiesen werden
Die Anfragen haben zugenommen. Jahr für Jahr müssen Kinder und Jugendliche abgewiesen werden, weil es keinen freien Platz für sie hat. So lässt sich die aktuelle Situation an den Aargauer Sonderschulen kurz zusammenfassen. Alle angefragten Schulleiterinnen und Schulleiter befürchten, dass die Anfragen in Zukunft noch weiter zunehmen, wenn die Volksschulen ab dem Schuljahr 2020/21 die Ressourcen als Schülerpauschale zugeteilt bekommen.
Kürzlich warnte Edgar Kohler, Präsident der Schulleitungskonferenz der Regionalschule Lenzburg, in der AZ: «Es besteht die Gefahr, dass Einzelfälle, für welche Regelschulen heute noch zusätzliche Ressourcen beantragen können, eher abgewiesen werden.» Das hätte zur Folge, dass Sonderschulen aus allen Nähten platzten, weil sie diese Kinder aufnehmen müssten.
Die Situation an den Sonderschulen hat sich in den letzten Jahren auch ohne pauschale Zuteilung der Ressourcen verändert. Laut Ueli Speich, dem Stiftungsleiter der Zentren Körperbehinderte Aargau (Zeka), ist die Nachfrage nach Plätzen in der Tagessonderschule massiv gestiegen. Zeka verfüge über 166 Plätze, die vom Kanton bezahlt werden.
Im Moment werden an den Schulen aber 179 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, weitere 12 bis 15 Kinder mit rechtsgültiger Zuweisung stünden auf der Warteliste. Obwohl Zeka auf Kinder mit einer körperlichen Behinderung spezialisiert sei, hätten sie vor allem Anfragen für Kinder mit einer sozialen Beeinträchtigung. Die Anfragen nach Plätzen für Kinder mit einer Körperbehinderung hätten in den letzten Jahren dank des integrationsunterstützenden, behinderungsspezifischen Beratungs- und Begleitdiensts von Zeka eher abgenommen.
Kinder landen am falschen Ort
Die Pläne des Kantons, sämtliche Ressourcen für die Volksschulen pauschal zuzuteilen, begrüsst Stiftungsleiter Speich nicht. Besser fände er ein System, das für die Regelschulen einen Anreiz schaffen würde, Kinder mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung zu integrieren. «Es darf zudem nicht vergessen werden, dass die meisten Kinder den Kanton weniger kosten würden, wenn sie eine Regelschule besuchen dürften.»
Carmen Priovano leitet die Heilpädagogische Schule Aarau. Sie stellt fest, dass im Aargau sonderpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit einer schweren Verhaltensauffälligkeit oder frühkindlichem Autismus im Vergleich zu anderen Kantonen rar sind oder fehlen. Deshalb würden diese Kinder oft in den heilpädagogischen Schulen platziert, «wo insbesondere die verhaltensauffälligen Kinder unter Umständen nicht entsprechend gefördert werden können».
Belastung für Lehrkräfte
Das sei nicht nur für die betroffenen Kinder und ihre Eltern frustrierend, sondern auch für das Personal. Kinder mit einer starken Verhaltensauffälligkeit oder einer schweren autistischen Störung würden in der Klasse meist sehr viel Raum einnehmen und die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden absorbieren. «Der Betreuungsschlüssel ist in den vergangenen Jahren aber immer gleich geblieben, was zu einer Mehrbelastung der Mitarbeitenden geführt hat, sodass die Qualität der Förderung aller Schülerinnen und Schüler nicht immer optimal ist», sagt die Schulleiterin.
Die Klassen an der heilpädagogischen Schule Aarau seien in den letzten vier, fünf Jahren grösser geworden, die Anfragen hätten um 30 Prozent zugenommen, sagt die Schulleiterin. «Wenn wir früher im Durchschnitt fünf Schülerinnen und Schüler in den Klassen hatten, dann sind es heute neun.» Sie führt den Anstieg darauf zurück, «dass Kinder mit vielfältigen Beeinträchtigungen viel eher von der Regelschule ausselektioniert werden».
Absage im letzten Moment
Aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der Schliessung der Kleinklassen seien die Klassen auch an den Regelschulen grösser geworden und stärker durchmischt. Gleichzeitig seien die personellen und finanziellen Ressourcen nicht im gleichen Mass gestiegen und es fehle an Heilpädagogen und Logopädinnen. Schulleiterin Pirovano befürchtet, dass sich die Situation mit der Pauschalisierung der Ressourcen noch stärker zuspitzen wird. «Weil das System Regelschule überlastet ist, werden mit grösster Wahrscheinlichkeit noch mehr Kinder als bisher selektioniert, weil sie nicht mehr adäquat gefördert werden können.»
Doch Pirovano muss bereits seit eineinhalb Jahren «etliche Kinder» abweisen. Dieses Jahr habe sie für gut zehn Kinder nach anderen Lösungen gesucht. Einige fanden Platz in einer anderen Sonderschule oder heilpädagogischen Schule im Aargau, andere werden nun an einer ausserkantonalen Schule unterrichtet. Können Kinder nicht die nächstgelegene heilpädagogische Schule besuchen, sei das für den Kanton wiederum mit höheren Transportkosten verbunden, sagt Pirovano.
Da Regelschulen kaum Kapazitäten haben, Kinder mit individuellem Förderbedarf aufzunehmen, ist es auch schwierig für die heilpädagogische Schule, Schülerinnen und Schüler wieder in die Regelschule zu reintegrieren. Im Durchschnitt könne pro Schuljahr ein Kind zurück an die Regelschule. Letztes Jahr habe sie sogar für drei Kinder Anstrengungen zur Reintegration unternommen. «Es ist uns aber nur bei einem Kind gelungen», sagt Pirovano. Zwei Kinder hätten im letzten Moment eine Absage erhalten. «Das ist für das Kind und uns natürlich extrem frustrierend.»
Zu viele Freiheiten
Dass es immer mehr Schülerinnen und Schüler mit sozialen Beeinträchtigungen gibt, spüren Sonderschulen, die sich auf diese Kinder und Jugendlichen spezialisiert haben, besonders. Zum Beispiel das Schulheim St. Johann in Klingnau. Schulleiter Luigi Giannini hat Platz für 57 Kinder und Jugendliche. Dieses Jahr habe er 30 Anmeldungen zurückweisen müssen. Vor allem die Anfragen nach Plätzen in den Tagesschulgruppen seien gestiegen.
Dem Kanton sei dieser Mangel an Plätzen bewusst, sagt Giannini. Auf Anfrage der AZ sagt das Bildungsdepartement, es seien zusätzliche Sonderschulplätze in Planung. Schulleiter Giannini begrüsst das. «Zusätzliche Plätze werden jedoch das Problem nicht lösen.» Heutzutage gebe es viele Kinder, deren Eltern ihnen eher zu viele Freiheiten geben. «Beim Einfordern von Regeln oder Verhaltensweisen stellt sich das als Schwierigkeit heraus», sagt Giannini. Es sei deshalb schwieriger geworden, Kinder alleine über strikte Regeln zu führen. «Das fordert uns alle, in den Institutionen und in der Volksschule, heraus.» Giannini ist überzeugt, dass über eine gute Beziehungsarbeit viel möglich ist. Jeder Schüler und jede Schülerin wolle es gut machen. «Macht führt aber beim Kind und dessen Eltern nur zu Widerstand.» Das sollte seiner Meinung nach auch in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer vermehrt thematisiert werden.