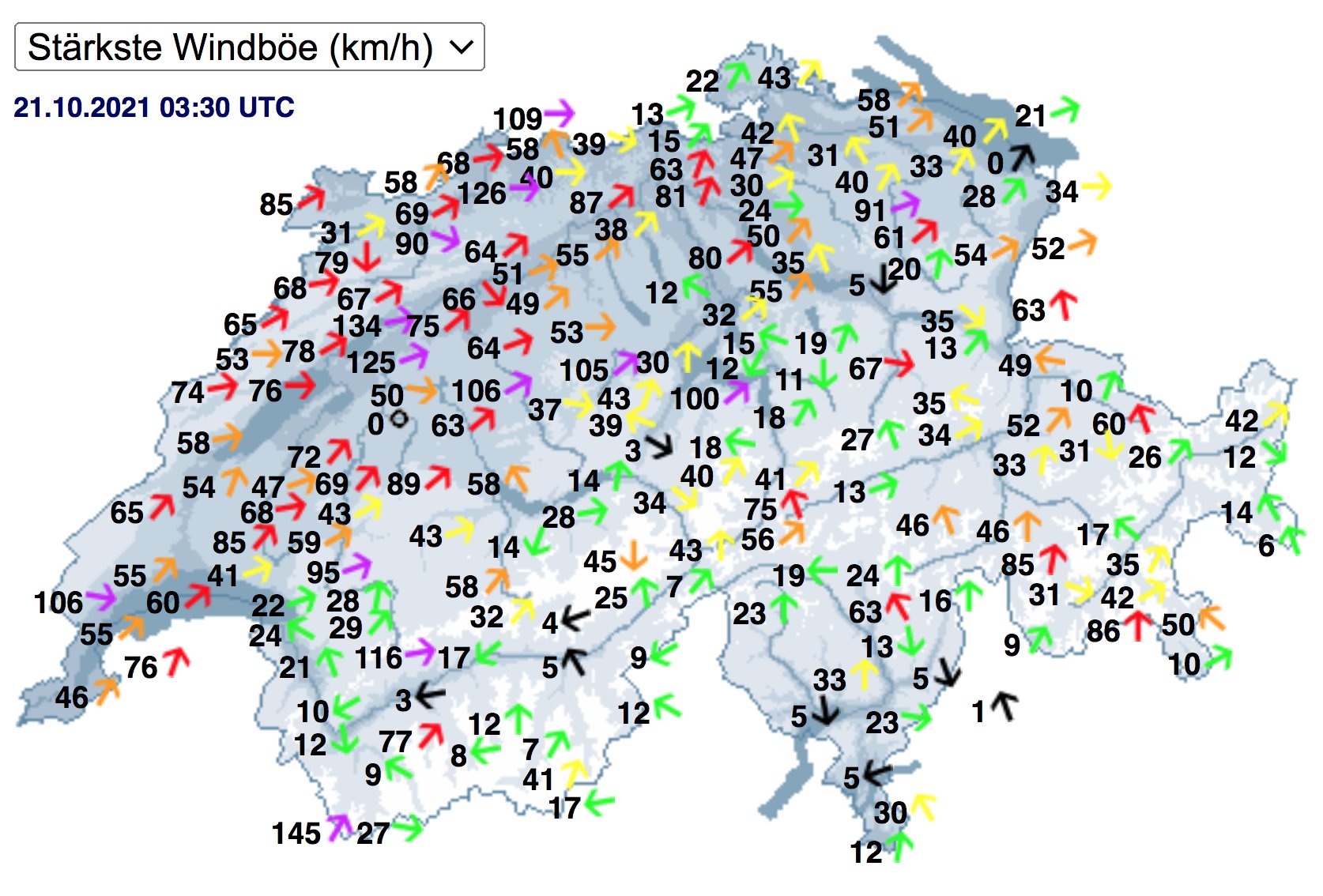55 Frosttage in Folge: 1929 erstarrte sogar die Aare in Rothrist
«Ein so langer und hartnäckiger Winter hat schon lange nicht mehr unsere Häuser belagert», konnte man am 6. Februar 1929 im Zofinger Tagblatt lesen. In jenem Winter brachte die Bise derart eisige Temperaturen aus dem Nordosten, dass sogar Aare und Rhein an einigen Stellen zu Eis erstarrten. Bereits Anfang Februar sanken die Temperaturen auf minus 17 Grad und im Verlaufe des Monats wurden in Kölliken gar minus 37 Grad gemessen. Am 19. Februar schrieb das Zofinger Tagblatt: «Eine wahrhaft sibirische Kältewoche liegt hinter uns», denn vom 10. bis 17. Februar lag der Temperaturdurchschnitt bei annähernd minus 14 Grad. Mit solch tiefen Temperaturen würde in der Praxis nicht gerechnet, schrieb ein Redaktor der Regionalzeitung. Dies würden die Thermometer mit unterer Skalagrenze bei minus 20 Grad sowie eingefrorene Wasserversorgungen beweisen. Besonders die Damen schienen zu frieren: «Endlich dürften auch die massgebenden Persönlichkeiten der Damenmode solche Temperaturanomalien nicht in Berechnung gezogen haben.» Speziell bei den Tanzanlässen müsse man vorsichtig sein: «Wie leicht erkältet man sich da, wenn das Tanzlokal gewechselt wird. (…) Also Vorsicht auch bei der Lustbarkeit!»
Erstarrte Aare in Rothrist
Neben zahlreichen zugefrorenen Seen und Flüssen bildete sich auch auf der gestauten Aare oberhalb des alten, längst abgerissenen Wehrs des ehemaligen Kanalkraftwerkes Ruppoldingen in Rothrist eine dicke Eisschicht, die teilweise in grosse Eisschollen zerbrach und unter Krachen und Knirschen ein zerklüftetes «Gletscherfeld» formte. Das seltene Naturereignis lockte unzählige Schaulustige an, die ihren Sonntagsspaziergang auf der gefrorenen Eisschicht machten. Doch die gewaltigen Kräfte der treibenden Eisschollen drohten das Wehr einzudrücken, also versuchte man mit Schlägel und Pickel kleine Kanäle ins Eis zu schlagen, die der Gewalt entgegenwirken sollten. Glücklicherweise zeigte die Massnahme Wirkung und das Wehr hielt stand. Um den Rechen beim Elektrizitätswerk freizukriegen, mussten 40 Mann aufgeboten werden, die das Werk von den Eisschollen frei hielten und somit vor dem Stillstand bewahrten.
Getränkefirmen profitierten
Die eisige Kälte kam in erster Linie den Getränkefirmen und Bierbrauereien gelegen. Diese benötigten im Depot für die Frischhaltung ihrer Produkte massenhaft Eis und legten dafür im Winter sogenannte Eismatten an. Auch in Oftringen wurde eine Wiese mit einem Erdwall eingefasst und mit Wasser aufgefüllt. Nach dem Kälteeinfall sägte man das Eis auf und lud die Eisblöcke mit Spezialzangen auf LKWs, welche die kalte Ladung in geeignete Lagerräume transportierten. Auch andernorts wurde aus der Kälte Nutzen gezogen. So titelte das Zofinger Tagblatt am 13. Februar 1929 : «Die Kälte bereichert den Sprachschatz.» Da das eisige Wetter Störungen im elektrischen Verteilungsnetz brachte, stiegen in diversen Bäckereien mit elektrischer Heizung die Backöfen aus. So kam es zur treffenden neuen Wortschöpfung: «So kalt, dass Backöfen einfrieren.» Doch in der aussergewöhnlichen Kälte hoffte man auf den Trost alter Weisheiten: «Weisser Februar stärkt die Felder», erzählte man sich mit dem sehnlichen Wunsch nach einem ertragreichen Sommer.
Bis zum 20. März hatten die Menschen mit viel dürftigeren Heizungsmöglichkeiten, als wir sie heute haben, ununterbrochen 55 Frosttage auszuhalten. Dann machte milderes Frühlingswetter die Leute glauben, der Winter sei überstanden. Doch Anfang April ereilte sie ein Rückschlag mit einem halben Meter Schnee in der Innerschweiz und drei Grad unter Null in Bern. Noch Mitte Monat gab es schneereiche Niederschläge. Am 25. Mai 1929 hiess es hoffnungsvoll im Zofinger Tagblatt: «Mit den Pfingsttagen ist das Schönwetter eingezogen», was sich dann schliesslich auch bewahrheitete.
von Elisa Marti