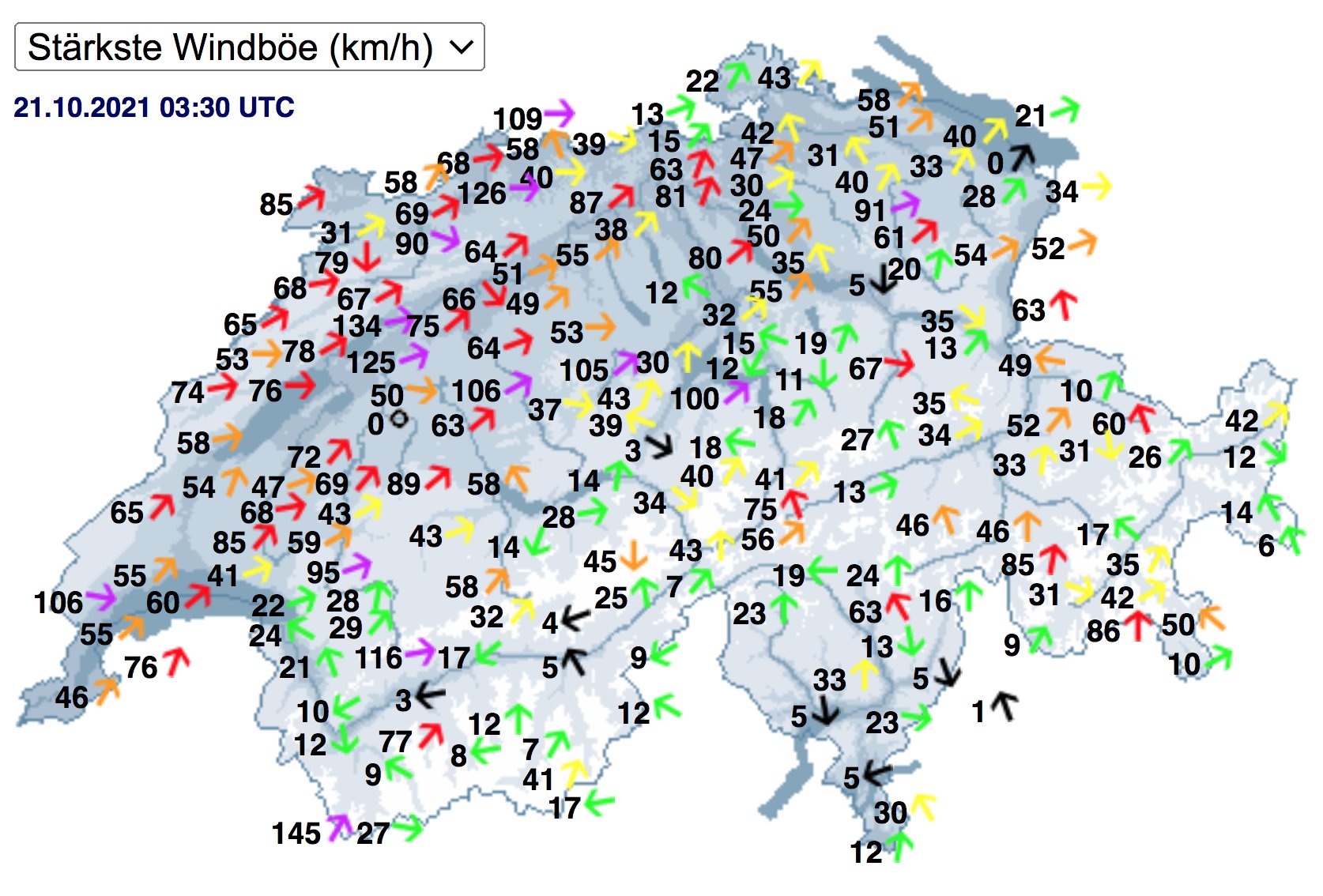Das Wetter spielt verrückt: Kälte und Regen bei uns, extreme Hitze im Norden
Wir ziehen uns den Pullover übers T-Shirt und hätten gern den Sommer zurück. Gleichzeitig fallen weltweit Hitzerekorde. 49,6 Grad Celsius wurden in Lytton gemessen, so heiss war es seit Menschengedenken noch nie in Kanada. Die Hitze führte dazu, dass das ganze Dorf niederbrannte und die Waldbrände kein Ende nehmen.
Und auch nördlich des Polarkreises ist es viel zu heiss. Im norwegischen Banak zeigte das Thermometer 34 Grad, das ist so warm wie nie, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Hitzerekorde im Norden, mieses Wetter und viel Regen in Mitteleuropa. Das Wetter spielt verrückt.

Felix Blumer, Meteorologe und Moderator bei SRF Meteo.
Kanada liegt auf dem 50. Breitengrad, also nicht viel südlicher als die Schweiz. Wären solche Hitzerekorde demnach auch bei uns möglich? Der Meteorologe Felix Blumer von SRF Meteo vergleicht die aktuelle Hitzephase in Kanada mit dem Jahrhundertsommer 2003 in der Schweiz. Blumer sagt:
«Der Jetstream wölbte sich über West-Kanada weit nach Norden und führte extreme heisse Luft von Süden in die Gegend.»
Der Jetstream ist ein Band von Westwinden, welche die Arktis in grosser Höhe umkreisen und sich dabei auf die Bewegung von Hoch- und Tiefdruckgebieten auswirken. Die Lage über Westkanada blieb dabei über Tage stabil, und so schaukelte sich die Hitze auf, ähnlich wie im Hitzesommer 2003 in der Schweiz, als wir uns wie in Bella Italia fühlten.
Hitzewellen sind auch bei uns möglich
Temperaturen knapp über 40 Grad will aber niemand und die könnten in den kommenden Jahren auch in der Schweiz möglich sein. «Werte im Bereich von 45 Grad sind aber höchstens bei einer ganz speziellen Föhn- oder Südwestlage und nur ganz lokal über eine kurze Dauer möglich», sagt Blumer.

Momentan frieren wir aber, und Kanada leidet unter der Hitze. Blumer relativiert die Rekordwerte allerdings. Jener von Lytton habe auch mit temporären Föhneffekten zu tun. Ausserhalb des Föhns bewegten sich die Temperaturen in der Gegend zwischen 40 und 45 Grad. «Das ist zwar immer noch sehr heiss, ist aber auch schon früher bei ähnlichen Wetterlagen aufgetreten», erklärt der Meteorologe. Die Gegend liegt etwa auf einem Breitengrad wie Valencia.
Erwärmung und Jetstream als Treiber
Fraglos häufen sich die Hitzeextreme aber und das gerade auch im Norden. Da spielen nach Blumer zwei Phänomene zusammen. Durch die Erderwärmung wird in den Polargebieten die Schneeauflage geringer, und im Frühjahr schmilzt der Schnee schneller.
Weil sich der apere Boden schneller erwärmt als der schneebedeckte, erwärmt sich die Luft viel stärker. «Durch diese zunehmende Erwärmung in den hohen Breiten und die entsprechend kleinere Temperaturdifferenz zwischen mittleren und hohen nördlichen Breiten scheint der Jetstream geschwächt zu werden», sagt Felix Blumer.
Wellenschlagender Jetstream
Der wellenschlagende Jetstream wird nach Norden und Süden umgelenkt. Wegen dieser Auslenkung nach Norden wird es in den Polargebieten über Wochen sommerlich heiss. Im Süden gibt es wegen des abgelenkten Jetstreams dagegen statt Wärme feucht-kühles Wetter. Dieses Jetstream-Phänomen gab es in den vergangenen Jahren öfter und wirkt an verschiedenen Orten. 2010 im westlichen Sibirien oder 2014 in weiten Teilen Sk andinaviens, als es dort ebenso heiss war wie jetzt.
Bei uns klagen wir dagegen über Nässe und Kälte. Nach Blumer war der Sommer allerdings gar nicht so übel: «Wenn wir von den verheerenden Schadensgewittern absehen, war der Sommer 2021 in der Schweiz bis jetzt besser als sein Ruf.» Der Juni gehörte an vielen Orten in der Schweiz sogar zu den fünf wärmsten seit Messbeginn im Jahr 1864. Die Verteilung des Regens war allerdings sehr unterschiedlich. Vom Genfersee bis zum westlichen Bodensee war der Juni stellenweise der nasseste seit Messbeginn. Im Süden und auch in Teilen des Bündnerlands war der Juni aber trockener als sonst.
Die Nässe im Mittelland hatte mit dem genannten Bauch des Jetstreams zu tun, der sich nach Westen auf den Atlantik hinaus verlagerte. Das führte zu einer häufigen Südwest- bis Südostströmung, die im Juni warme Luft, aber auch viele Gewitter mit Starkregen brachte. «Daran änderte sich im Juli wenig, und auch in den kommenden Tagen liegen wir häufig am östlichen Rand von Höhenkaltluft über den Britischen Inseln. Es geht also mit Südwestwind und Gewittern weiter», sagt Blumer.
Nässe und Kälte verzögern Obstreife
Bei solchen Aussichten fragt man sich, was das mit dem Obst in unserem Land macht. Wegen des Wetters habe sich der Start der einheimischen Früchtesaison um rund zwei Wochen verzögert, sagt Beatrice Rüttimann vom Schweizer Obstverband. Somit seien die Früchte generell um zwei Wochen später reif. «Der Regen erhöht zudem das Risiko für Pflanzenkrankheiten und Fäulnis. Die Obstproduzenten haben mehr Aufwand, um die Früchte auszusortieren.»
Grundsätzlich begünstigt Wasser das Wachstum des Obstes, die Früchte werden grösser. Im professionellen Obstanbau sind die Kulturen zudem meist durch Foliendächer vor Wasser und Hagel geschützt. Der Saisonstart war zwar durch den frostigen, nassen und sonnenarmen Frühling verzögert, der warme Juni hat das aber wieder einigermassen ausgeglichen, und deshalb sei die Qualität der Früchte nach wie vor gut.
Wir allerdings wünschen uns einige trockene Baditage zum Ferienbeginn. In Südeuropa wird es daran nicht fehlen. Am kommenden Wochenende rollt eine Hitzewelle von der Sahara her übers Mittelmeer.