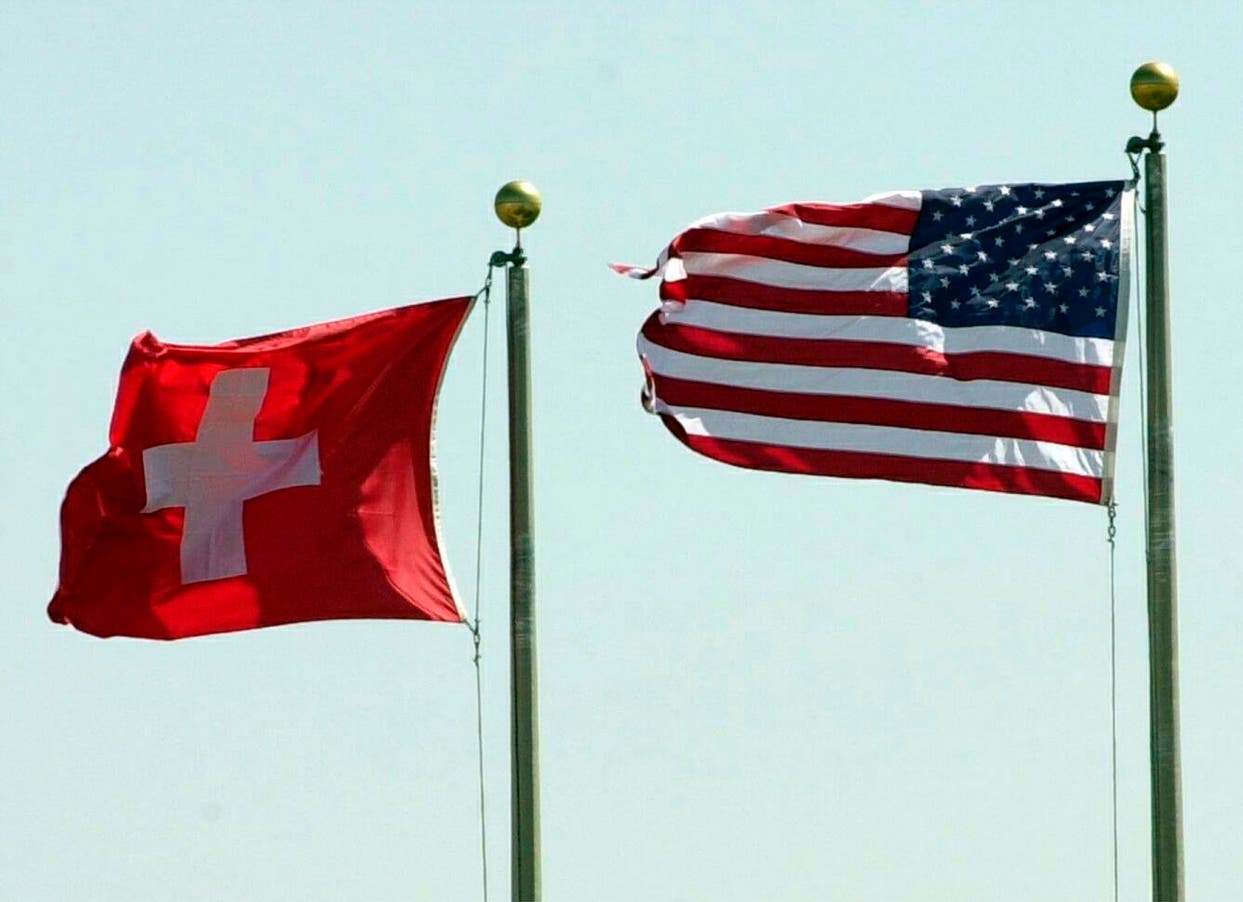Reto Ringger ist Pionier des nachhaltigen Anlegens – und sieht ein Problem: «Für Anleger ist es nicht mehr durchschaubar»
Die Börse boomt
Warum purzeln die Rekorde?
Die Aussicht auf eine rasche Erholung der Weltkonjunktur treibt die Aktienmärkte in immer luftigere Höhen. Der Swiss-Market-Index erreichte Ende Mai mit über 11’500 Punkten ein neues Allzeithoch. Und seit Februar hat es in der internationalen Börsenstatistik keinen Monat mit sinkenden Aktienkursen mehr gegeben. Inzwischen werden auch Rohstoffanlagen wieder stark gesucht. In den vergangenen Tagen gehörten an der Londoner Börse die Aktien der grössten Klimasünder wie Glencore, Anglo American oder Rio Tinto mit Kursavancen von bis zu acht Prozent zu den Gewinnern. Auch die Erdöltitel werden seit der jüngsten Beschränkung der Fördermengen durch die Opec stark gesucht. Natürlich sind inzwischen auch die Aktien von Flugzeugbauern wie Airbus wieder voll im Aufwind, schliesslich kann ja die Reisesaison bald wieder losgehen. Was das alles für Anleger heisst, die mit ihren Investitionen ganz auf klimaschonende Aktien setzen bleibt abzuwarten. Es ist zu hoffen, dass sich nachhaltiges Anlegen weiterhin lohnen wird. Übrigens: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat Ende Mai den hiesigen Banken und Versicherungen erstmals konkrete Auflagen zur Offenlegung derer Klimarisiken gemacht. Diese Transparenzpflichten sollen einerseits die Aktionäre und die Kunden dieser Finanzdienstleister vor unliebsamen Überraschungen schützen und gleichzeitig zur Eindämmung des verbreiteten Etikettenschwindels mit Nachhaltigkeitsanlagen («Green Washing») beitragen.
Ist es heute einfacher, nachhaltig Geld anzulegen als vor 25 Jahren?
Sowohl als auch. Einfacher ist es deshalb, weil das Angebot seither sehr stark gewachsen ist. Es gibt viel mehr Anlagemöglichkeiten. Zudem hat das Nachhaltigkeitsresearch über Unternehmen und Märkte deutlich mehr Tiefgang als damals.
Und wo ist es schwieriger geworden?
Es herrscht ein grosses Durcheinander. Jede Bank hat eine eigene Methodik und ein eigenes Nachhaltigkeits-Label. Für den Anleger ist das nicht mehr überschaubar.
Fehlt es denn auch an Transparenz?
Auch, aber jeder Anbieter hat eine andere Definition von Nachhaltigkeit und das führt zu einer völlig unterschiedlichen Bewertung der Unternehmen.
Sie gelten als Erfinder des Dow-Jones-Sustainability-Index, den es seit 1999 gibt. Das war wohl einer der ersten Versuche, eine solche Methodik hinzubekommen?
Ja. Der DJS-Index war für uns ein Mittel, um dem Markt nachhaltige Anlagen näher zu bringen. Als wir 1995 mit der Firma SAM (Sustainable Asset Management, Anm. d. Red.) an den Start gingen begann das Interesse institutioneller Investoren an nachhaltigen Anlagen zu erwachen. Aber im breiten Markt herrschte immer noch die Meinung vor, Rendite und Nachhaltigkeit stünden in einem negativen Zusammenhang.
Sie mussten also die Wahrnehmung des Marktes umkehren.
Genau. Der Index half uns dabei, die Vorteile nachhaltiger Anlagestrategien nachvollziehbar aufzuzeigen. Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde damals im Markt noch kaum verstanden.
Aber immerhin fanden Sie mit Dow Jones einen Indexanbieter, der an die Zukunft nachhaltiger Anlagen glaubte.
Ja, für mich ist das heute noch erstaunlich. Nachhaltigkeit war damals eine Sache für Greenpeace oder für den WWF, aber sicher nicht für ein urkapitalistisches Medium wie Dow Jones, die auch das Wall Street Journal besassen. Dass Dow Jones 1997 bereit war, mit einem kleinen Schweizer Start-up einen solchen visionären Index zu lancieren, nimmt sich im Rückblick doch ziemlich mutig aus.
Was denken Sie heute über den Index?
Der DJS-Index verfolgt bis heute den Best-in-Class-Ansatz. Er nimmt die Firmen mit dem besten Nachhaltigkeitsrating aus jedem Sektor auf, auch aus dem Erdölsektor oder aus der Automobilindustrie. Das hatte einst seine Berechtigung. Aber heute ist der Best-in-Class-Ansatz überholt.
Trotzdem ist er immer noch weit verbreitet. Ist er nun ein Feigenblatt für rückständige Fondsanbieter?
Wenn sich ein Anbieter mit dem Best-in-Class-Ansatz immer noch als fortschrittlich darstellen will, dann ist das eine sehr einfache Form von Nachhaltigkeit. Ein Exxon-Investment wird nicht nachhaltiger, wenn es in einem Portefeuille etwas tiefer gewichtet wird.
Was ist denn heute der richtige Ansatz, wenn es Best-in-Classe nicht mehr ist?
Nachhaltigkeit ist keine relative Angelegenheit. Wir wollen die globale Erwärmung auf zwei Grad beschränken oder den Rückgang der Biodiversität stoppen. Das sind absolute Ziele und keine relativen Zielgrössen.
Im Nachhaltigkeitsjargon ist immer von den ESG-Kriterien die Rede. Gemeint ist aber oft nur das «E» für Environment. Warum?
Die anderen Faktoren («S» für Soziales und das «G» für Governance oder gute Unternehmensführung, Anm. d. Red.) sind weniger erforscht. Es gibt weniger harte Daten etwa über die Folgen einer unsozialen Lohnpolitik oder einer Unternehmenskultur, in der es zum Beispiel Raum für korrupte Praktiken gibt. Aber auch das ändert sich langsam.
Was ändert sich?
Wir kommen jetzt in eine Phase, in der es zu vielen Bereichen von ESG viel mehr Transparenz geben wird. Zum Beispiel ist Amazon in den meisten ESG-Portefeuilles vertreten. Ist Amazon deshalb ein nachhaltiges Investment? Da gibt es viele kontroverse Themen und die Finanzbranche beginnt sich erst jetzt mit diesen kontroversen Themen zu beschäftigen.
Warum ist das so?
Der Finanzsektor ist im Unterschied zu anderen Branchen in erster Linie von rein monetären Anreizen getrieben. Das ist eindimensional und dabei können kaum langfristige Ziele und Visionen entstehen. Es gibt visionäre Unternehmer in der Kunst, in der Mode oder in der Technik, aber kaum in der Finanzwirtschaft.
Sind wir als gewöhnliche Anleger nicht auch vor allem von monetären Anreizen getrieben?
Das ist sicher eine wichtige Zielsetzung. Aber immer mehr Anleger wollen eine marktgerechte Rendite und gleichzeitig mit den Anlagen nachhaltige Ziele verfolgen. Bei der Generation der Millenials beispielsweise wollen über 80 Prozent nachhaltig anlegen. Wir befinden uns an einem Tipping Point und die Finanzbranche muss rasch umdenken.
Kann die Finanzindustrie dies auch liefern?
Aktuell wir noch mehr versprochen als geliefert. Der neue Purpose der UBS lautet beispielsweise «Connecting people for a better world». Das ist in der Umsetzung schon sehr anforderungsreich.
Wird mehr versprochen, als am Ende gehalten werden kann?
Das Feld für Enttäuschungen ist gross und die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Versprechen auch gelebt werden.
Warum sind sie so skeptisch?
Weil diese Versprechungen massives Umdenken und neue Geschäftsmodelle voraussetzen. Für alteingesessene Anbieter ist so ein grosser Wechsel aber sehr, sehr schwierig. Viele Banken verdienen immer noch gutes Geld mit «schmutzigen» Branchen. Auf diese – auch bonusrelevanten – Einnahmen zu verzichten, ist schwierig.
Wann kommt die Probe aufs Exempel?
Wir sind bereits mittendrin. Der weltweit grösste Vermögensverwalter BlackRock verspricht zum Beispiel, die Unternehmen aktiv zur Umsetzung einer nachhaltigen Geschäftspolitik anzutreiben. Doch BlackRock ist auch der grösste Anbieter von passiven Anlageprodukten und muss daher in diese Unternehmen investieren. Auch berät er solche Unternehmen und verdient dabei. Das sind grosse Interessenkonflikte, die überwunden werden müssen.
Sie haben ihre Firma SAM 2010 an den niederländischen Finanzkonzern Robeco verkauft. Warum haben Sie das getan?
Einer unserer Grossaktionäre – eine grosse deutsche Versicherung – kam in grosse finanzielle Schwierigkeiten und musste seine Beteiligungen – darunter auch SAM – abstossen. Das war eine schlimme Erfahrung für mich. SAM war mein Baby und ich musste als Gründer und CEO diesen Verkauf durchführen.

Ein Jahr später wurden Sie Private Banker.
Falsch. Ich bin Unternehmer und habe eine Bank gegründet.
Wer sind die Kunden Ihrer Globalance Bank?
Unsere Kundschaft ist sehr heterogen. Der gemeinsame Nenner besteht darin, dass die Kunden mit ihrem Geld etwas Positives bewirken möchten. Unser Claim heisst denn auch «mehr als Geld bewegen». Mehr als die Hälfte sind Frauen. Auch viele Unternehmer, Familien oder Stiftungen kommen zu uns.
Sie haben neun Jahre gebraucht, um in die Gewinnzone zu gelangen. Warum so lange?
Zum einen haben wir immer in Research und neue Technologien investiert. Zum anderen sind Bankkunden sehr träge und nicht sehr wechselbereit. Viele Kunden sind mit ihrer Bank nicht zufrieden, trotzdem wechseln sie nicht. Trotzdem sind wir 2019 und 2020 mit je rund 50 Prozent gewachsen. Wir verwalten aktuell Kundenvermögen von knapp 1.7 Milliarden Franken.
Sie haben gesagt, dass die Finanzbranche viel zu stark von kurzfristigen monetären Anreizen geleitet ist. Mit welchen Anreizen arbeiten Sie in Ihrer Bank?
Wir haben einen starken «Purpose», das ist wichtig. Zudem sind alle unsere Mitarbeitenden Aktionäre. Wir zahlen gute Löhne, aber keine kurzfristigen Cash-Boni wie traditionelle Banken. Wir wollen keine Söldner-Kultur. Ich glaube unsere Mitarbeiter arbeiten bei uns, weil das finanzielle und das kulturelle Umfeld für sie stimmt.
Warum glauben Sie das?
Unsere Mitarbeitenden sind gesuchte Spezialisten und werden von anderen Banken stark umworben. Wir haben aber praktisch keine Abgänge, was ein starkes Zeichen ist.
Welche Ziele haben Sie noch?
Wir wollen unsere Kunden begeistern, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, den Finanzmarkt bewegen und dann werden auch die finanziellen Zahlen stimmen.
Reto Ringger, der Nachhaltigkeits-Pionier
Reto Ringger machte sich 1995 mit der Firma Sustainable Asset Management (SAM) selbständig. Bald darauf lancierte das Unternehmen die ersten Nachhaltigkeitsfonds. 1997 gelang dem heute 58-jährigen Zürcher ein Husarenstück. Er konnte den US-Indexanbieter Dow Jones dazu bewegen, auf Grundlage des SAM-Research den ersten globalen Nachhaltigkeits-Index, den Dow-Jones-Sustainability-Index zu entwickeln. Der Index wurde 1999 lanciert und erreicht durch seine einfache Methodik (Best-in-Class) sofort eine grosse Abdeckung der globalen Aktienmärkte. 2010 musste Ringger seine SAM verkaufen, nachdem ein Kernaktionär in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Ein Jahr später gründete er in Zürich die Globalance Bank, die aktuell rund 30 Mitarbeitende zählt und auf einen steilen Wachstumspfad eingeschwenkt ist. Ringger hat an der Universität Zürich ein Ökonomiestudium absolviert. Er ist Vater einer 15-jährigen Tochter.