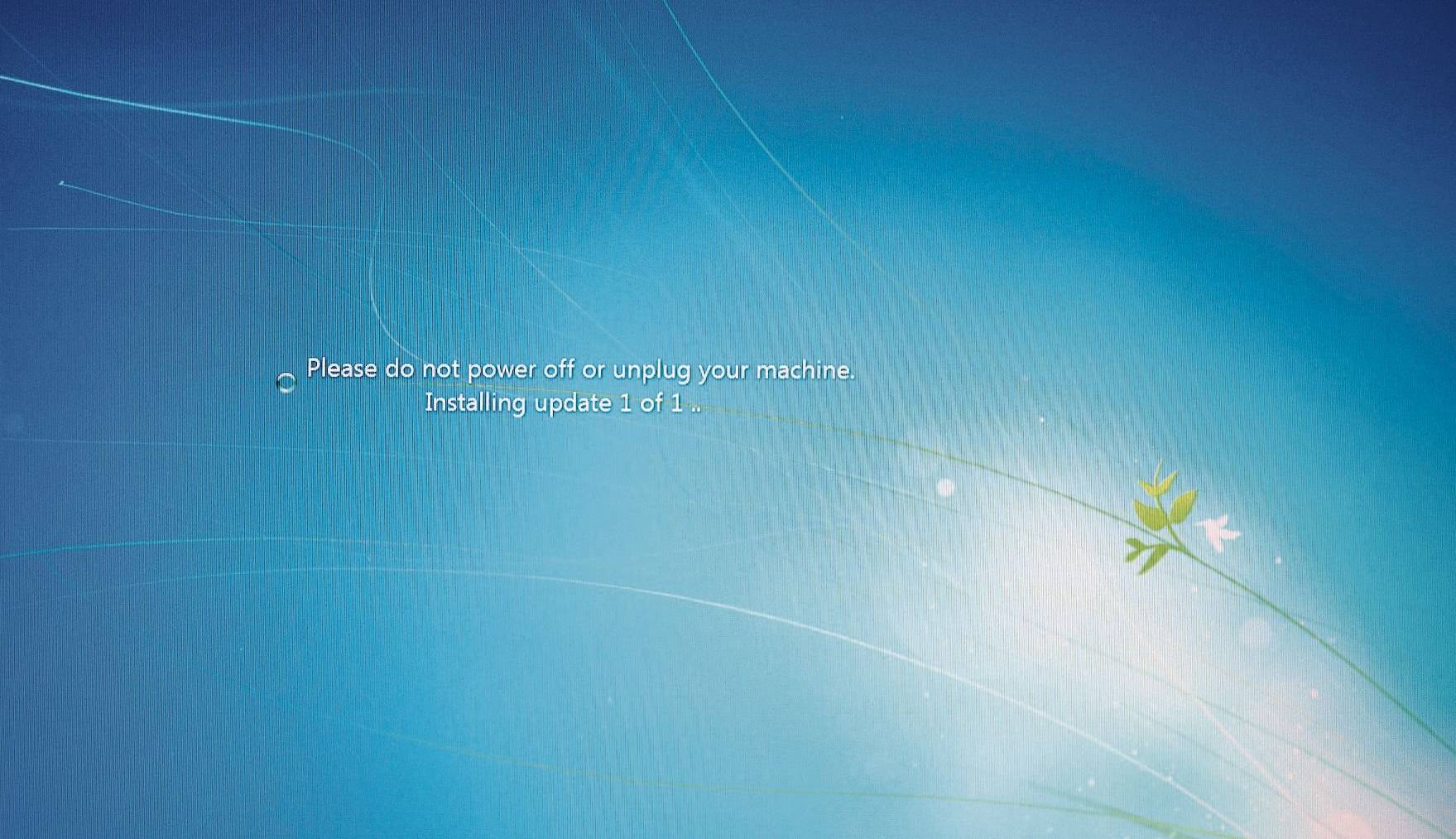Das Smartphone: nichts anderes als eine freiwillige elektronische Fussfessel
In jedem dritten US-Haushalt steht mittlerweile ein Smart Speaker wie Amazon Echo oder Google Home. Mit Alexa das Badewasser einlassen oder die Mikrowelle einschalten, das klingt bequem und smart. Doch die digitalen Diener, als die uns die Industrie diese schicken Gadgets verkaufen will, sind eben auch Überwachungswerkzeuge: Tech-Konzerne wie Apple, Amazon und Google ließen Vertragsarbeiter reihenweise Audio-Mitschnitte ihrer Nutzer auswerten: Patientengespräche, Drogengeschäfte, Sex – minutiös wurde das Leben der Anderen protokolliert. In einem mysteriösen Mordfall in den USA sollte Alexa gar als Zeugin aussagen. Drei Freunde hatten einen feucht-fröhlichen American-Football-Abend vor dem Fernseher verbracht. In der Nacht lag einer der Männer tot im Pool. Die Polizei verlangte daraufhin von Amazon die Herausgabe der Audio-Dateien.
CIA zapfte Smart-TVs an – und hörte mit
Der Netzwerklautsprecher hört laufend mit – und könnte ein tödliches Geheimnis hüten. Was geschah zur Tatzeit? Kam es zwischen den Freunden zum Streit? Gab es Schreie des Opfers? Amazon gab die Daten nach anfänglichem Zögern schließlich doch heraus. Zwar fanden sich in den Aufzeichnungen keine belastenden Indizien für den Strafprozess. Dennoch zeigt sich hier eine unheilvolle Allianz zwischen dem Staat und privaten Akteuren, die wie ein digitaler Detektiv Vorermittlungen durchführen und bis ins Innerste der Wohnstuben vordringen.
Auch Google hat schon in dutzenden Fällen Suchmaschinen- oder Standortdaten an Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Nach Recherchen der Enthüllungsplattform Wikileaks hat die CIA von ihrer Frankfurter Zentrale aus mit einem Hackertool Smart-TVs angezapft und in einen Fake-Off-Modus gestellt, der dem Nutzer suggerierte, er hätte den Fernseher abgeschaltet. Doch das gehackte Gerät war aktiviert – und lauschte mit. Die eigenen vier Wände werden zu einer telematischen Überwachungszelle.
Es genügt die Illusion einer Überwachung
Der französische Philosoph Michel Foucault hat in seinem Werk «Überwachen und Strafen» (1975) ausgeführt, wie mit dem Panopticon – jener ringförmigen Anlage, in deren Mitte ein Aufseher in einem Turm Einblick in die geöffneten Zellen hat – eine Überwachungsmaschinerie entsteht, welche die «Macht automatisiert und individualisiert». Der psychologische Trick an der Architektur ist, dass Kontrolle auch dann funktioniert, wenn der Häftling gar nicht unter Beobachtung steht, weil er jeden Moment damit rechnen muss, dass der Wärter in die Zelle hineinlugt. Es genügt also die Illusion der Überwachung.
Nach Foucault ist es unmöglich, ein flächendeckendes Kontroll- und Überwachungsregime einzuführen. Selbst wenn man, wie in China, hunderte Millionen Videokameras installiert, wird es immer noch Schlupflöcher und tote Winkel geben. Die effektivste und ökonomischste Form der Überwachung ist es, wenn der Überwachte sich selbst überwacht.
Wir bewegen uns wie Freigänger im offenen Vollzug
Und das tut er: mit miniaturisierten Tatortkoffern namens Smartphones, deren integrierte Sensoren, Kameras und Mikrofone uns rund um die Uhr tracken und digitale Spuren sichern. Mit diesen elektronischen Fußfesseln, die wir uns freiwillig umlegen, bewegen wir uns wie Freigänger im offenen Vollzug – die Geräte funken Standortdaten an zentrale Server, erstellen Bewegungsprofile und kontrollieren die Aktivitäten der Träger.
Wir bauen uns unser eigenes Datengefängnis, das schon gar keine Mauern mehr braucht, um die Insassen zu kasernieren. Künstliche Agenten tun genau das, was ein Gefängniswärter tut: Sie überwachen die Gefangenen, hören sie ab, beobachten ihr Verhalten, durchsuchen ihre Räume, kontrollieren Schritte und Anwesenheit und beaufsichtigen sie beim Aufenthalt im Freien. Der Siegeszug des Smartphones, das von den Tech-Konzernen als ultimatives Ermächtigungswerkzeug gefeiert wird, ist auch ein später historischer Triumph der Gefängnisinstitution.
Niemand wird gezwungen, als scheint freiwillig
Gewiss kann man einwenden, dass man sich frei im öffentlichen Raum bewegen kann (das Gefühl des Freiheitsverlusts stellt sich vielmehr ein, wenn man sein Handy zu Hause vergessen hat). Niemand ist gezwungen, sich einen Lauschsprecher in sein Wohnzimmer zu stellen. Und natürlich hat man auch schon im analogen Zeitalter Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen: Fingerabdrücke etwa, die sich mit modernen forensischen Verfahren entschlüsseln lassen. Doch mit der Verbreitung biometrischer Authentifizierungssysteme sehen wir nun, dass sich erkennungsdienstliche Behandlungen normalisieren.
Mit denselben anthropometrischen Techniken, mit denen Kriminelle registriert werden – Fingerabdrücke, Gesichtsscans, Profile – entsperrt man heute sein Smartphone oder bezahlt im Restaurant. Es ist im Grunde so, als würde man alle paar hundert Meter in eine Polizeikontrolle geraten. Doch merkt man diese Eingriffsintensität gar nicht, gerade weil die Untersuchungen und Überprüfungen am Datenkörper so diskret und unscheinbar sind – und weil man an der perpetuierten Rasterfahndung bereitwillig mitwirkt.
BigData sperrt Unschuldige in Dänemark ein
Welche Folgen dieses Massenscreening hat, lässt sich in Dänemark studieren. Dort hat die Regierung eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt, die Telekommunikationsanbieter verpflichtet, Metadaten von Kunden wie Signalstandorte und Anrufdauer zwei Jahre lang zu speichern und auf Antrag der Polizei offenzulegen. Aufgrund einer IT-Panne wurden die als Beweismittel genutzten Telekommunikationsdaten, etwa Bewegungsmuster von Handy-Besitzern, falsch konvertiert. Das System hatte die Mobiltelefone Funkzellen zugeordnet, die zum Teil hunderte Kilometer entfernt waren – mit der Folge, dass Unschuldige aufgrund der verzerrten Standortdaten inhaftiert wurden und Straftäter ungeschoren davonkamen. 32 Gefängnisinsassen wurden daraufhin entlassen, die Justiz prüft zehntausende Fälle. Im Datendunst weiß das blinde Auge der Justitia nicht mehr, was Recht und Unrecht ist. Der Fall macht deutlich, wie die Gefängnismauern den gesamten Gesellschaftskörper umschließen – und wir angesichts der Überwachungsregime unsere Freiheit verlieren.
Adrian Lobe ist Politikwissenschaftler und freier Publizist und schreibt regelmäßig für diese Zeitung. 2017 wurde er mit dem Journalistenpreis der Stiftung Datenschutz ausgezeichnet. Vor wenigen Tagen erschien sein Buch «Speichern und Strafen. Die Gesellschaft im Datengefängnis» bei C.H. Beck.