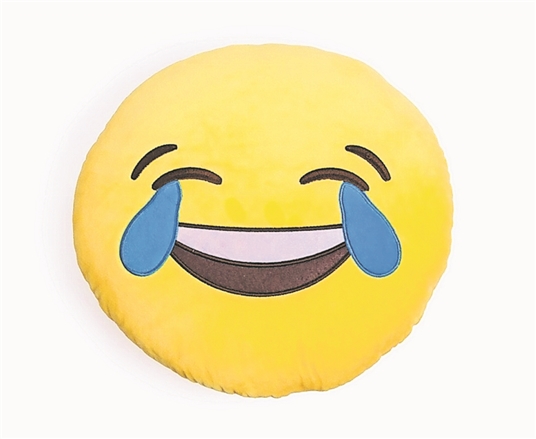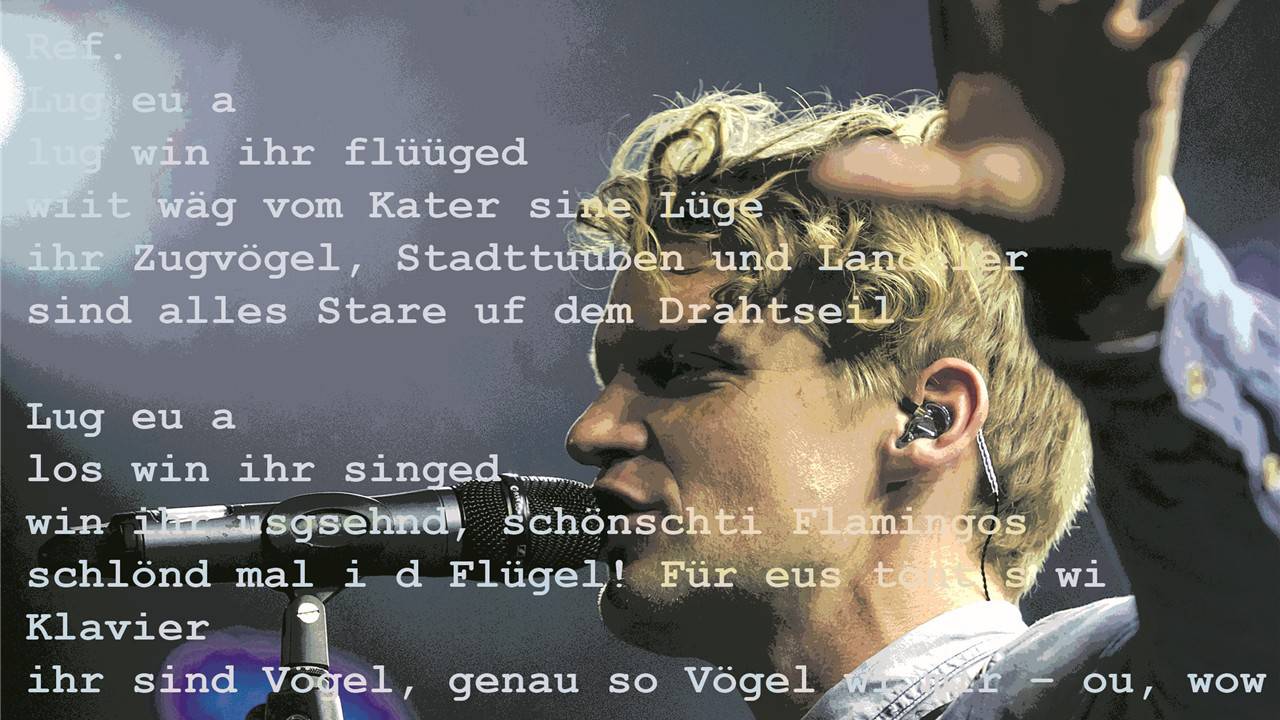
Die neue Mundart: Die Butter verdrängt den Anken – und statt «usgruebet» wird «gechillt»
Es gibt so viele Sprachexperten wie Einwohner. Sie beobachten eine Ausbreitung des Dialekts in Sphären, die früher dem Schriftdeutschen vorbehalten waren. Gleichzeitig mischen sich Wörter aus dem Hochdeutschen oder Englischen in die Dialekte. Die Butter verdrängt den Anken. Und statt «usgruebet» wird «gechillt». Darum wird immer wieder vor dem Niedergang der Mundart gewarnt. Regula Schmidlin ist Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Freiburg und hat einen nüchternen Blick auf unsere Dialekte. Die auf Zürichdeutsch gestellten Fragen beantwortete sie auf Baseldeutsch.
Initiativen verlangen, dass das Kantonsparlament auf Mundart diskutiert, Firmen werben auf Schweizerdeutsch, und es gibt Dialekt-Kurse. Ist das Schweizerdeutsche auf dem Vormarsch?
Regula Schmidlin: Es kommt darauf an, welchen Zeitraum man anschaut. In den Medien zum Beispiel hat der Mundartgebrauch zwischen 1970 und 1990 von 33 auf 66 Prozent zugenommen. Heute ist der Mundartanteil am Radio etwa achtzig Prozent, am Fernsehen etwa fünfzig Prozent. Der hohe Mundartanteil hat mit der grossen Zahl an informellen Sendungen zu tun. Es gibt zum Teil auch eine Gegenbewegung. Manche Nachrichtenformate sind seit 2007 konsequent Hochdeutsch.
Die Jugend schreibt SMS auf Schweizerdeutsch. Verlernt sie, hochdeutsch zu schreiben?
Nein. Bei Schulbesuchen beobachte ich das Gegenteil. Die Kinder lernen schon sehr früh, sich in der Standardsprache auszudrücken, etwa weil sie Vorträge halten, oder mit Schülern, die noch nicht lange hier leben, Hochdeutsch sprechen. Die schweizerdeutschen Whatsapp-Chats ersetzen nicht hochdeutsch geschriebene Briefe, sondern eher das Gespräch auf dem Dorfplatz. Erhebungen zeigen zudem, dass die allermeisten in ihrem Alltag sowohl Dialekt als auch Standardsprache sprechen. Noch 1990 gaben bei einer Volkszählung sehr viele Schweizer an, nie Hochdeutsch zu sprechen. 2015 ist diese Gruppe praktisch auf null geschrumpft.
Sobald Schweizerdeutsch in Situationen verwendet wird, wo früher Hochdeutsch gesprochen wurde, erweitert das den Dialekt. Pfarrer, die auf Dialekt predigen, übernehmen zum Beispiel standarddeutsche Formulierungen. Am Arbeitsplatz kommen Anglizismen hinzu. Man spricht von einem Ausbaudialekt. Die Mundart muss sich erweitern, um neue Funktionen zu erfüllen.
Dadurch klingt der Dialekt aber zunehmend hochdeutsch. Zum Beispiel hört man Wörter wie «Heruseforderige».
Ja, das tut manchen Leuten weh. Plötzlich hört man «Treppe» statt «Stägä» oder «Kartoffel» statt «Härdöpfel». Zu beobachten sind auch Auswirkungen auf die Grammatik. Auf Schweizerdeutsch gibt es theoretisch nur das Relativpronomen «wo», aber man hört auch Sätze wie: «Das isch d Frau, dere du aaglüütet häsch.» Das Klagen über die Verluderung des Dialekts durch fremde Einflüsse ist aber so alt wie die Mundart selbst. Es gibt einen Text aus 1930er-Jahren. Der Autor beschwert sich darin über Zürcher Schülerinnen der Nähschule, die «nähen» statt «büezen» und «stricken» statt «lismen» sagen.
Machen solche Einflüsse den Dialekt nicht kaputt?
Nicht unbedingt. Es kommen zwar neue Wörter hinzu, aber wie das Beispiel mit den Näherinnen zeigt, bleiben die alten Begriffe geläufig. Zudem ist das Gerüst der Sprache stabil. Aussprache, Betonung und Melodie bleiben über die Jahre gleich. Wenn wir Wörter aus dem Hochdeutschen oder aus dem Englischen übernehmen, sprechen wir sie schweizerdeutsch aus.
Boomen alle Dialekte gleich, oder gibt es solche, die weniger gebraucht werden?
Das Verhältnis zwischen Dialekt und Standardsprache ist in allen Kantonen etwa gleich. Es gibt also keine Region, in der schneller ins Standarddeutsche gewechselt wird als anderswo. Der Kanton Bern sticht aber aufgrund seiner kulturellen Produktion heraus. Das hat mit der literarischen Tradition zu tun, zum Beispiel mit Mani Matter und Kurt Marti. Ob es wirklich mit dem Klang des Dialekts zu tun hat, ist schwer zu beurteilen.
Gibt es auch Dialekte die sich ausbreiten, und andere, die eher zurückgehen?
Ja, Dialekte aus urbanen Zentren verbreiten sich in den Agglomerationen. Ich kenne das von mir selber. Ich stamme aus dem Laufental und sage eigentlich «hinge» und «unge», nach meinem Umzug nach Basel vor 25 Jahren begann ich aber damit, «hinde» und «unde» zu sagen. Auffällig ist aber eine andere Entwicklung. Die sogenannte l-Vokalisierung breitet sich aus. Regionen, die früher «Milch» sagten, sprechen heute von «Miuch». Noch vor einigen Jahren war es selbst in Bern verpönt, «gäub» statt «gälb» zu sagen. Heute sagen alle «gäub».
Und dann breitet sich seit einiger Zeit das «S» als Mehrzahl-Endung aus.
Ja, nun hört man die Pluralform «Meitlis» statt «Meitli» oder auch «Rösser» statt «Ross». Das ist eine spannende Entwicklung, weil sie dem Trend der Ökonomisierung der Sprache widerspricht. Wörter werden eben nicht zwingend immer kürzer und Sätze knapper, sondern es gibt auch einen Trend zur Differenzierung. Weil das Wort «Ross» sowohl Einzahl als auch Mehrzahl bedeutet, kommt es zu Verwechslungen, die mit dem Begriff «Rösser» vermieden werden können.
Sprachwissenschafter wie Sie nehmen solche Veränderungen der Sprache immer sehr gelassen. Regen Sie sich denn nie auf, zum Beispiel, wenn fast jedes zweite Wort Englisch ist?
Doch, doch, wenn ich im Tram höre, dass es «wider total crowded» sei, finde ich das etwas aufgesetzt. Kürzlich fragten meine Kinder, wann es wieder einmal «Kartoffeln» gebe. Da erinnerte ich sie daran, dass man auch «Härdöpfel» sagen kann. Aber als Wissenschafterin untersuche und beschreibe ich den Sprachwandel. Es steht mir nicht zu, Vorschriften zu machen, wie andere sprechen sollen. Das wäre unwissenschaftlich.
Bedrohen Kartoffeln statt Härdöpfel nicht die Existenz des Dialekts?
Das glaube ich nicht. Diese Angst wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgebracht. Der Dialekt ist aber nicht verschwunden. Vielmehr ist das Interesse an ihm gestiegen. Von daher bin ich zuversichtlich, dass die Dialekte überleben.
Wenn wir heute eine Sprachnachricht aufnehmen und sie in hundert Jahren abgehört würde, würden unsere Nachfahren uns verstehen?
Es wird ihnen gleich gehen wie uns, wenn wir 100 Jahre alte Aufnahmen hören. Gewisse Begriffe werden aus der Mode gekommen sein, aber im Grossen und Ganzen werden sie uns verstehen. Durch neue Medien ist die Kommunikation zwar schneller geworden. Der Sprachwandel hat sich dadurch aber nicht beschleunigt. Schwer verständlich für andere sind vor allem Szenesprachen und Fachsprachen. Wenn wir heute zum Beispiel Aufnahmen von Jugendlichen aus der Halbstarken-Bewegung anhören, verstehen wir viele Begriffe nicht. Das hat aber nicht mit dem zeitlichen Abstand zu tun, sondern mit Szene-Codes. Grundsätzlich sind Prognosen darüber, wie die Sprache in 100 Jahren aussieht, aber Kaffeesatzlesen.