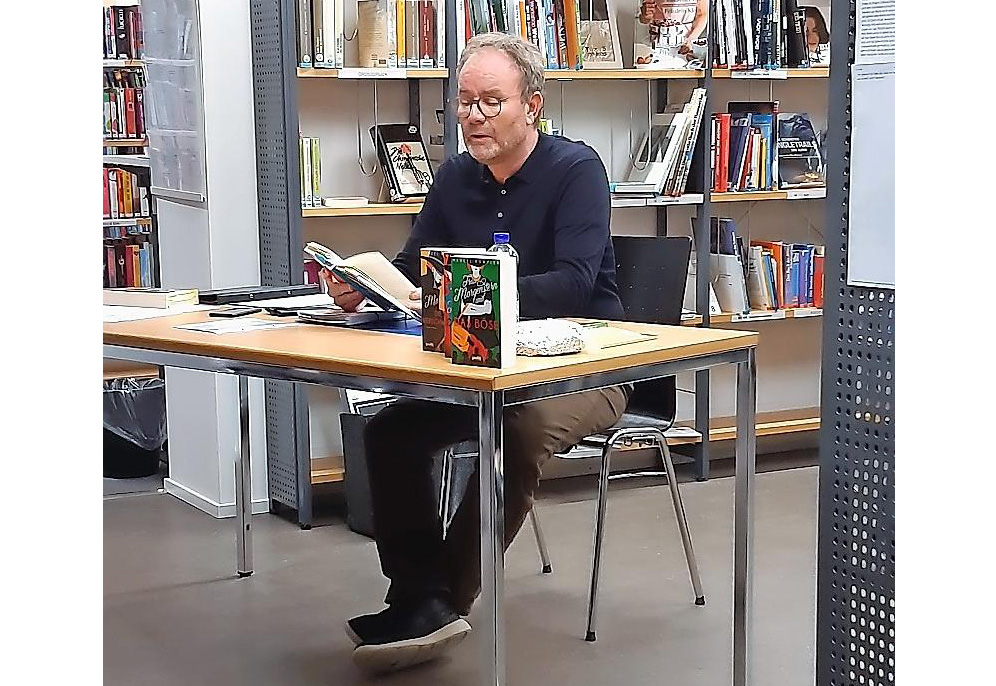Die Schweizer, die in Afrika überwintern
Bei schönem Wetter präsentiert sich zurzeit im Himmel ein Naturspektakel. Unzählige Vogelzüge begeben sich in den Süden. Während sie wärmere Gegenden aufsuchen, laufen die sogenannten Beringungsstationen heiss, wo den Vögeln ein Ring zur Identifikation angemacht wird. Die nächstgelegene Beringungsstation befindet sich auf dem Subigerberg. Beat Rüegger, Präsident des Naturschutzvereins Rothrist, leitet am kommenden Samstag eine Exkursion dorthin. «Die Beringung ist wichtig für die Erhaltung der Arten. Es reicht nämlich nicht, wenn man den Vogel bei uns schützt. Auch sein Überwinterungsgebiet muss in einem entsprechenden Zustand bleiben. Dafür müssen wir wissen, wo unsere Vögel im Winter leben», sagt Rüegger. Ausserdem könne man damit die Entwicklung der Vogelbestände verfolgen. Doch zurück zum Anfang: Wie funktioniert das Ganze genau?
Einfach eine Zeit lang den Himmel beobachten
Bereits Ende Juli/Anfang August begeben sich die ersten Zugvögel Richtung Süden. Zurzeit trifft man in den Lüften vor allem Schwärme ziehender Kleinvögel an. So beobachtete Beat Rüegger auf einer Anhöhe vor seinem Haus mehrere Hundert Ringeltauben und Stare, aber auch Buchfinken, Feldlerchen und Eichelhäher. «Wenn man sich mal nach draussen begibt und eine Zeit lang den Himmel beobachtet, merkt man, dass immer mal wieder Vögel Richtung Südwesten vorbeiziehen», so Rüegger. Auf den Beringungsstationen werden die Vögel in sogenannten Japannetzen gefangen, die um die zehn Meter breit sind und zwischen zwei Pfosten gespannt hängen. Im Subigerberg, wo die Exkursion des Naturschutzvereins hinführt, stehen die Netze vor Büschen und sind so für die Vögel praktisch unsichtbar. Das Netz bremst das Tier ab und es fällt hinein, wobei es sich vor allem mit den Füssen im Netz verheddert. Der Kontrolleur löst den Vogel mit viel Fingerspitzengefühl aus dem Netz und platziert ihn in einem Stoffsack. Dieser wird anschliessend in die Beringungsstation gebracht. «Das Wichtigste ist, dass dem Vogel nichts passiert», so der 61-jährige Ornithologe aus Rothrist. Auch deshalb kann das Beringen nur ohne Regen stattfinden, weil das Wasser ansonsten ins Gefieder läuft und sich der Vogel lebensgefährlich unterkühlen könnte.
Bereits in jungen Jahren hat Beat Rüegger einem Freund beim Beringen von Vögeln assistiert. «Ich hatte Freude, wenn wir einen seltenen Vogel im Netz hatten», erinnert er sich zurück. Mit 18 Jahren hat er schliesslich selbst die Prüfung abgelegt, für die er mit den ausgestopften Vögeln des Museums Basel geübt hatte. Heute darf man nur noch mit einem Auftrag der Vogelwarte Sempach Vögel beringen. Diese stellt seit 1924 die jeweiligen Ringe zur Verfügung und koordiniert den Informationsaustausch mit den anderen Vogelwarten der Welt – und mit allfälligen Findern. «Wer einen beringten Vogel bei sich im Garten oder sonst wo findet und dies der Vogelwarte Sempach meldet, erfährt nachher, woher der Vogel kam», so Rüegger. Das sei eine Art Belohnung für den Meldeaufwand.
Setzt sich das GPS für Vögel durch?
Von rund 1000 beringten Vögeln, die in der Schweiz gefangen und beringt werden, wird im Schnitt nur einer zurückgemeldet. «Die Welt ist gross, nicht jeder Vogel wird gefunden», erklärt sich Beat Rüegger diese tiefe Rückmeldequote. Deshalb sei das Beringen auch zusehends in die Kritik geraten. Hinzu kommt, dass man heutzutage technisch fortgeschrittene Mittel hat, die die Fluglänge und Zeit bestimmen können. Diese sogenannten Geodatenlogger werden statt des Rings am Vogel angebracht. Wenn der Vogel in einem Jahr hoffentlich wieder an seinen Brutplatz in der Schweiz zurückkehrt, zeigen diese auf, wo der Vogel überall war.
Nicht nur die Technik hat sich in den letzten Jahren verändert. Der Klimawandel und die veränderten Lebensumstände machen den Vögeln vermehrt zu schaffen. «Viele Arten stossen weiter nach Norden vor oder verschieben sich in höhere Lagen», meint Rüegger. So lebt das Alpenschneehuhn im Gebirge bei Temperaturen unter 15 Grad. Verschieben sich die tiefen Temperaturen immer weiter in die Höhe, so findet es bald keinen Lebensraum mehr. Der vermehrte Einsatz von Pestiziden im Kulturland ist ein weiteres Problem, das Rüegger nennt: «Die Vogelbestände im Landwirtschaftsgebiet haben stark abgenommen.» Genau deshalb nennt sich Rüegger eher «Naturschützer» als «Tierfreund». Mit dem Naturschutzverein versucht er, lokal zu wirken, damit die Natur eine Chance hat: «Ich versuche, den Lebensraum zu erhalten, damit die Vögel dort leben können.»
Exkursion zur Vogel-Beringungsstation Subigerberg, 19. Oktober. 8 Uhr Treffpunkt Schulhaus Dörfli. Fahrt mit Privatautos. Wanderung zur Beringungsstation dauert ca. 45 min. Rückkehr um ca. 13 Uhr nach Rothrist.