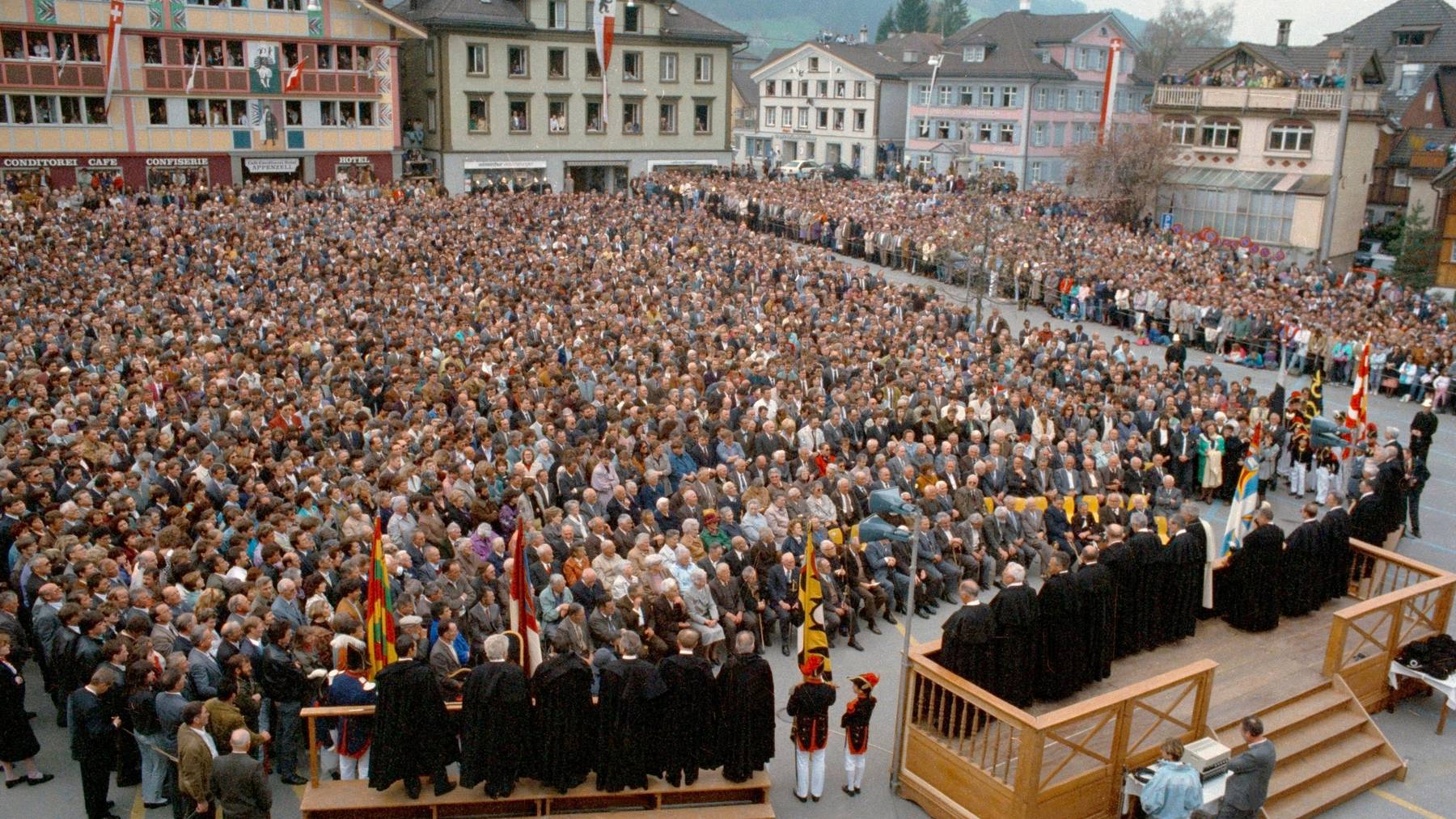Knappes Resultat im Aargau: Beschwerde blockierte das Frauenstimmrecht

Am 7. Februar 1971 sagten 65,7 Prozent der Schweizer Männer ja zum Frauenstimmrecht. Im Aargau hing der Entscheid an einem dünnen Faden – mit 39 469 gegen 39 229 Stimmen fiel das Ja zum Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene äusserst knapp aus. Für das positive Resultat ausschlaggebend waren die Bezirke Aarau, Baden, Brugg, Rheinfelden und Zofingen. Am selben Tag beschlossen die Aargauer zudem, ihren Frauen das Stimm- und Wahlrecht auch in Gemeinde- und Kantonsangelegenheiten einzuräumen. In der Deutschschweiz besassen dieses Recht nur die Frauen der beiden Basel sowie der Kantone Luzern und Zürich. Mit 40 444 gegen 37 776 Stimmen (Bezirk Zofingen 5493 Ja zu 4773 Nein) war der Ausgang dieser Abstimmung eindeutiger. Kurios, dass es beispielsweise in Wiliberg (die eidgenössischen Resultate finden sich in der Tabelle) mit 20 zu 14 Stimmen ein Ja gab.
Vier Monate nach der Einführung des Frauenstimmrechts kam es zur ersten Volksabstimmung mit weiblicher Beteiligung. Am 6. Juni durften die Aargauerinnen im Rahmen der 225. Volksabstimmung in der Geschichte des Bundesstaats zu zwei eidgenössischen Fragen (Umweltschutzartikel und Bundesfinanzordnung) Stellung nehmen. Ihre Rechte auf Kantonsebene diesbezüglich waren durch eine Abstimmungsbeschwerde blockiert. Man(n) versuchte via Bundesgericht das Resultat annullieren zu lassen.
Das Frauenstimmrecht war seit 1918 ein Thema im Grossen Rat
Einzug in die politische Debatte im Kanton Aargau hielt das Thema Frauenstimmrecht am 29. November 1918, als der freisinnige Lenzburger Grossrat Arthur Widmer in einer Motion die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts sowie Stimmrechts für Frauen im Bereich des Kirchen-, Schul-, Armen- und Krankenwesens forderte. Das Parlament modifizierte den Vorstoss und beschränkte sich auf das passive Wahlrecht. Der Regierungsrat nahm die Motion entgegen und stellte deren Behandlung mit der Totalrevision der Kantonsverfassung (ein Werk, dessen Vollendung sich bis 1980 hinzog) in Aussicht.
Im Jahr 1945 hakte Widmer, inzwischen Lenzburger Stadtammann und zudem Mitglied des Nationalrats, nach und stellte nochmals dieselbe Forderung. Im Januar 1947 beschloss der Grosse Rat mit 88 zu 67 Stimmen Nichteintreten. Aus diesem Grund (und weil nie eine Volksinitiative lanciert wurde) kam es im Aargau bis 1971 zu keiner Volksabstimmung über das kantonale Frauenstimm- und Wahlrecht. Dessen Einführung auf Bundesebene verwarfen die Aargauer Männer 1958. Der Journalist und spätere FDP-Regierungsrat Kurt Lareida liess die Sache nicht auf sich beruhen und verlangte 1966 die verfassungsmässige Voraussetzung für das Frauenstimmrecht. Sein Vorstoss sah eine Umsetzung in zwei Schritten vor. Erst sollten die Männer den Frauen die bürgerlichen Rechte einräumen und anschliessend die Aargauerinnen in einer Abstimmung entscheiden, ob sie diese überhaupt wollen. Exakt diese erhob der Grosse Rat nach der ersten Lesung der Verfassungsänderung zum Beschluss.
Erst anderthalb Jahre später, am 18. August 1970, machte sich der Grosse Rat an die zweite Lesung der Vorlage. Unter dem Eindruck der bevorstehenden Abstimmung über das eidgenössische Frauenstimmrecht kam sie nun ohne den Passus einer Konsultativabstimmung unter Frauen daher.
Hans Güntert, damals Doyen der Aargauer Journalisten, berichtete mit süffisantem Unterton über die denkwürdige Parlamentssitzung: «Auf der Tribüne sassen die Damen reihenweise und blickten von oben herab gelassen ins Halbrund, wo sich die edlen Ritter in Minneliedern auf die unveräusserlichen Rechte des zarten Geschlechts gegenseitig ausstachen. Man hat die Tragikomödie Frauenstimmrecht auf der gleichen Bühne auch schon in anderer Fassung gesehen, und die neuste Bearbeitung entspricht weniger einer im Aargau geketzerten Einsicht als vielmehr dem positiven Trend in vielen anderen Kantonen: In diesem helvetischen Strom glaubten nun auch die Deputierten, im Land der Ströme einigermassen gefahrlos mitschwimmen zu können.»
Mit 126 gegen nur 8 Stimmen empfahl die Ratsmehrheit ihren Geschlechtsgenossen draussen im Volk die Einführung des Frauenstimmrechts. Unter den Unentwegten, welche noch immer ein Nein auf ihre Fahne geschrieben hatten, befand sich der Safenwiler Jakob Hüssy. Güntert attestierte ihm Mut zur Unpopularität, ging aber hart mit ihm ins Gericht. «Seiner altväterischen Ansicht nach gehört die Frau wie eh und je in Küche und Kindbett, und unvermeidlich erscheint ihm der Zusammenbruch von Sitte und Moral, wenn die reine Hausmutter durch die garstigen Geschäfte der Politik befleckt werde.»
Ein Argument jener «Hausmütter», die sich aktiv gegen das Frauenstimmrecht einsetzten, war jenes des Stimmzwangs. Als Mütter hätten sie Mühe, die Stimmpflicht zu erfüllen.» Genau diese fiel angesichts der neu mehr als doppelt so grossen Zahl an Stimmberechtigten. Grosse Gemeinden sahen sich zudem gezwungen, Abschied von der Gemeindeversammlung zu nehmen (die Lokalitäten waren zu klein) und den Einwohnerrat einzuführen.
Im Oktober 1971 kam es zu den ersten Wahlen mit Frauenbeteiligung. Es galt den National- und Ständerat neu zu besetzen. Von den Aargauerinnen schaffte keine Einzige den Sprung nach Bern. Die ersten Aargauer Frauen mit einem politischen Mandat gab es erst nach den Grossratswahlen vom März 1973. 13 Frauen (6 Vertreterinnen der SP – unter ihnen Ruth Gammeter aus Strengelbach –, 4 der CVP, 2 der EVP und eine Grossrätin der Nationalen Aktion) wurden in den damals 200-köpfigen Rat gewählt. Auf den Listen von FDP und SVP gab es keine Kandidatinnen.