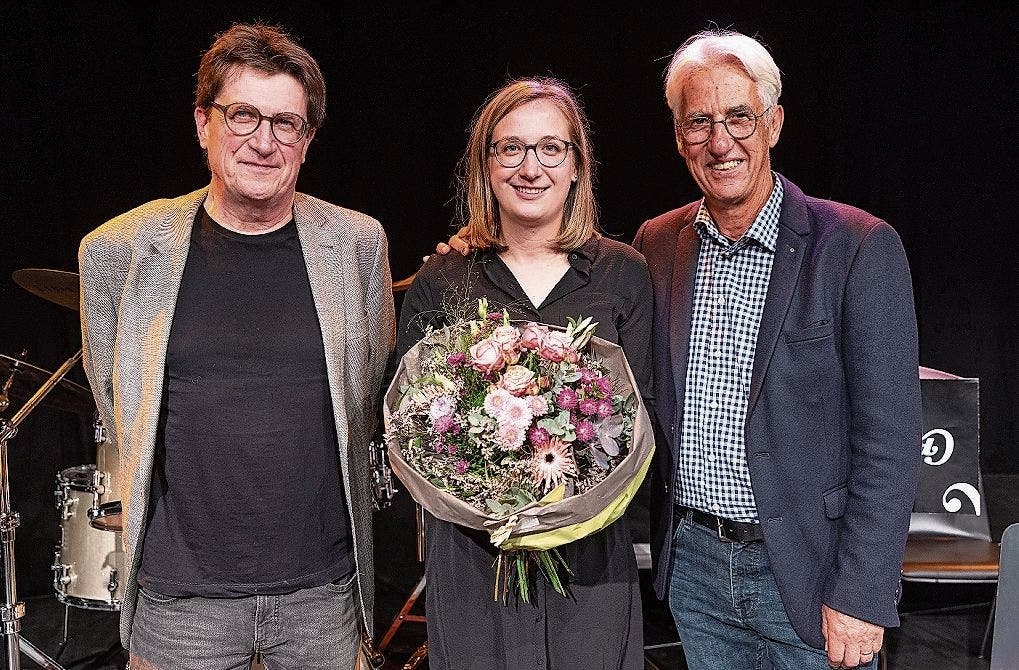Neue Sammlung zur Kantonsarchäologie: Zu besichtigende Funde sind bis 80’000 Jahre alt
Die Solothurner Kantonsarchäologie hat soeben ein Büchlein herausgebracht, in welchem sie die Neukonzeption ihrer Sammlung im dritten Stock des Hauses der Museen in Olten vorstellt. Chronologisch werden die wichtigsten Funde und Fundstätten vorgestellt. Die ältesten Funde auf Kantonsgebiet sind bekanntlich Werkzeuge aus Feuerstein, wie sie Neandertaler gebraucht hatten. Sie sind zwischen 40’000 und 80’000 Jahren alt. Eine wichtige Fundstelle ist die Kastelhöhle im Kaltbrunnental, wo zwischen 1948 und 1950 wichtige Funde gemacht wurden.
Auf Kantonsgebiet fand man bei Ausgrabungen am Inkwilersee Beweise, die zeigen, dass das Gebiet in der Jungsteinzeit, aber auch bis zur späten Bronzezeit bewohnt war. Siedlungen gab es aber in der Bronzezeit (2200–800 v.Chr.) auch auf den fruchtbaren Terrassen entlang des Jurasüdfusses. Solche Höhensiedlungen gab es auf der Frohburg bei Olten, der Lehnfluh bei Oensingen, dem Gross Chastel bei Lostorf oder auf der Portifluh bei Nunningen. Manche Siedlungen konnten damals schon erfolgreich wichtige Handelsrouten kontrollieren, andere lagen eher versteckt.
Ab dem 2.Jahrhundert v.Chr. wird Handel mit den römischen Nachbarn im Süden betrieben. Um 15v.Chr. passt sich die einheimische Bevölkerung dem römischen Lebensstil an. Nach dem Untergang des Römischen Reiches verändern sich die Städte. Sie wurden kleiner und mit Befestigungsmauern gesichert. So in Solothurn und in Olten. Die Bevölkerung zog sich aus Sicherheitsgründen auf die Jurahügel zurück, da alemannische Kriegerscharen plündernd durchs Mittelland zogen.
Solothurn romanisch, Olten alemannisch
Eine Besonderheit ist, dass das Gebiet des Kantons Solothurn seit dem Frühmittelalter (500–700 n.Chr.) zwei unterschiedlichen Kulturgruppen angehört. Dies ist anhand von Funden von Grabbeigaben ersichtlich. Der Norden und der Westen sind vorwiegend romanisch, der Osten alemannisch geprägt. Die Skelettfunde aus den Gräbern verraten vieles über die Lebensgewohnheiten der damaligen Menschen.
Die meisten sterben, bevor sie 45 Jahre alt sind. Die Frauen sind durchschnittlich 1,61m gross, die Männer 1,71. Zwischen 600 und 1000 n.Chr. wird Eisen gewonnen. In Büsserach wurde eine Handwerkersiedlung entdeckt, wo im grossen Stil Eisen hergestellt wurde. Bewacht wurden solche Siedlungen und die Lebensweise der Bauern von Adligen, die sich in trutzigen Burgen aufhielten. Oft standen solche Burgen – viele auch heute noch – auf einer Anhöhe, wo sie vor Angriffen geschützt waren und gleichzeitig die Juraübergänge kontrollieren konnten. Im Spätmittelalter (1250–1500 n.Chr.) bestimmten reiche Handwerker und Gewerbetreibende das Leben. Kirchen und Klöster wurden gebaut. Sie waren die ersten Lehranstalten, in denen Bücher geschrieben und gelesen wurden.
Für die heutige Archäologie erweisen sich oft das «stille Örtchen» oder eine Abfallgrube als eine reiche Fundgrube. Darin sind Auskünfte über Ernährungs- und Lebensweise auszumachen. Auch solches wird im Büchlein beschrieben. Darüber hinaus werden die grossen Schaubilder der Ausstellung im Haus der Museen nochmals kurz beschrieben und abgebildet.
Diese 60-seitige Broschüre ist in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch erhältlich. Gedacht ist sie als eine Art Amuse-bouche für Interessierte, sich die archäologische Sammlung des Kantons Solothurn doch dann einmal im Original anzusehen.