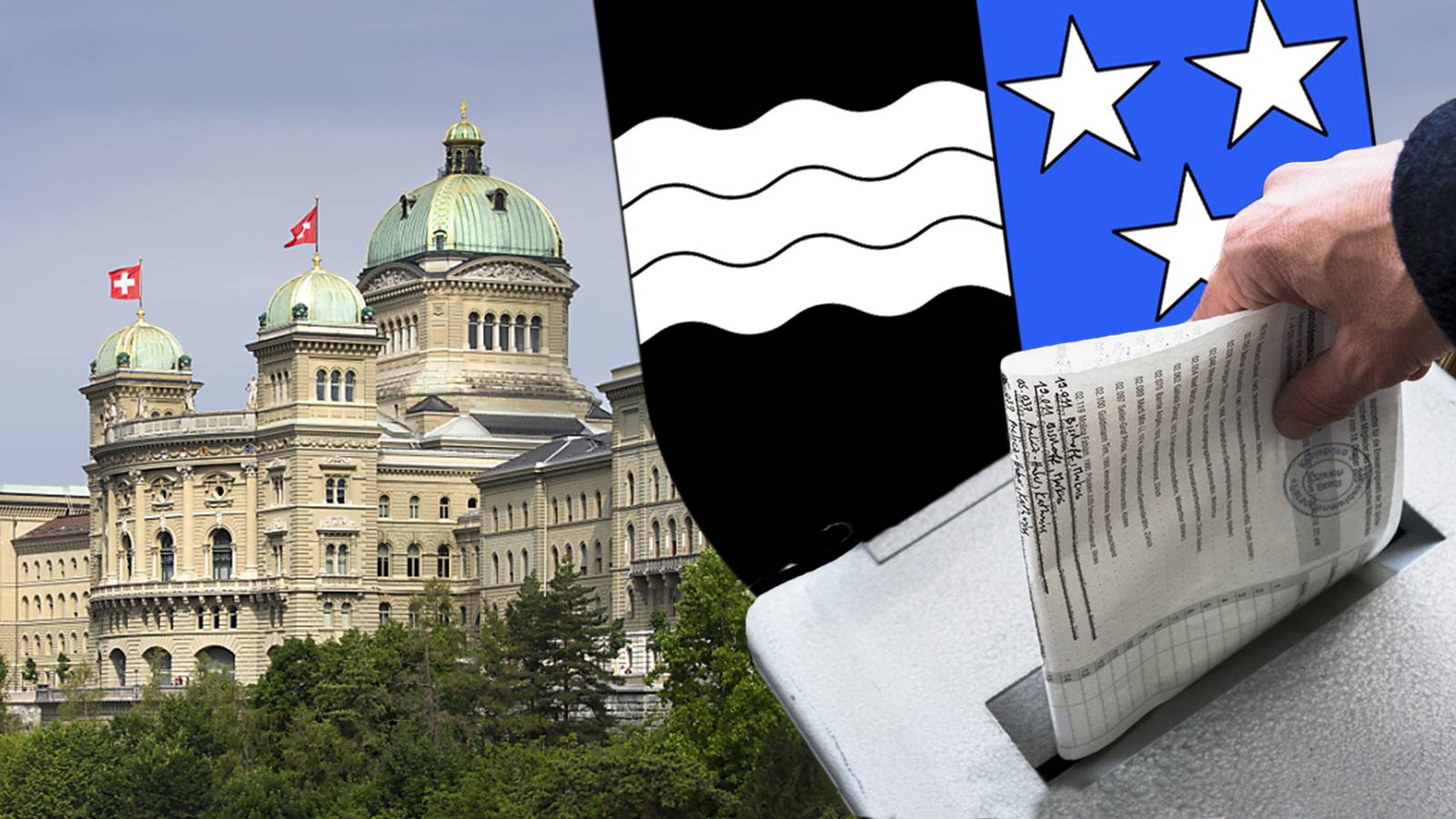Proporzverfahren: Kampf gegen die Zersplitterung
WAHLSERIE
Vor hundert Jahren wechselte die Schweiz für ihre Nationalratswahlen vom Majorz- zum Proporzsystem. Eine Wahlserie wirft einen Blick zurück ins Jahr 1919, zeigt aber auch die Unterschiede zwischen dem Proporz bei Gross- und Einwohnerratswahlen sowie jenem bei den Nationalratswahlen auf.
Das geltende Wahlverfahren für den Nationalrat – es ist nach seinem Urheber, dem Basler Physiker Eduard Hagenbach-Bischoff (1833–1910) benannt – bevorzugt die grossen Parteien. So hat die SVP 2015 landesweit mit 29,4 Prozent der Stimmen 32,5 Prozent der Sitze gewonnen – womit sie sechs Sitze mehr erhielt, als ihr nach ihrem Wähleranteil zustünde. Die zweitgrösste Partei, die SP, hat fünf Sitze zusätzlich. Unterrepräsentiert sind die Mitteparteien und die Grünen.
Kampf der politischen Zersplitterung
Diese gewollte Bevorzugung soll im Schweizer Politsystem für Stabilität sorgen – und einer Zersplitterung des Parlaments entgegenwirken. Bewerkstelligt wird sie durch das Instrument des Restmandats.
In einem ersten Schritt wird die Zahl der abgegebenen Parteistimmen durch die Anzahl Sitze + 1 geteilt. Damit erhält man die sogenannte Verteilungszahl. Dazu ein theoretisches Beispiel: Bei 60 000 Parteistimmen und drei Sitzen wäre die Verteilungszahl 20 000.
– Zweiter Schritt: So oft die Verteilungszahl in der Stimmenanzahl einer Partei Platz hat, so viele Sitze gibt es für die einzelne Partei. Beispiel: Die A-Partei hat 38 000 Stimmen, die für einen Sitz nötige Zahl ist 20 000 – ergibt 1 Sitz.
– Dritter Schritt: Falls ein Sitz übrig bleibt (Restmandat) wird bei jeder Liste die Stimmenzahl durch die bereits erhaltenen Sitze + 1 geteilt. Jene Liste mit dem grössten Quotienten aus dieser Rechnung hat den Sitz. Profitieren können oft die grössten Parteien oder Listenverbindungen.
Die Methode des Friedrich Pukelsheim
Auch das Aargauer Kantonsparlament wurde einst nach diesem System gewählt. Anlässlich der Verkleinerung des Grossen Rats von 200 auf 140 Sitze bemängelte das Bundesgericht jedoch Wahlkreise mit weniger als zehn Mandaten – sah die Grenze zur Majorzwahl geritzt. Majorz ist die Mehrheitswahl, wie wir sie für den Stände- oder Regierungsrat kennen.
Die Lösung lieferte 2009 der inzwischen emeritierte Augsburger Statistikprofessor Friedrich Pukelsheim. Er gewichtet die abgegebenen Stimmen zunächst auf Kantonsebene. Hier entscheidet sich, wie viele Sitze eine Partei im Grossen Rat bekommt. Bei einer zweiten Zuteilung muss festgelegt werden, in welchen Wahlkreisen (Bezirken) die Sitze realisiert wurden.
Einen gewichtigen Haken hat das Ganze. Friedrich Pukelsheim hat über seine Methode einmal gesagt: «Mein System bildet jeden ‹Muckser› der Wählerschaft ab. – Ob das gut ist, muss die Politik entscheiden.» In der Tat war das neue Parlament arg fragmentiert, worauf man eine Wahlhürde installierte.
Die EDU nahm die Hürde im Bezirk Kulm
Nur Listen mit mehr als 5 Prozent Wähleranteil in einem Bezirk oder 3 Prozent im Kanton werden berücksichtigt. Der EDU gelang es, im Bezirk Kulm bei zwei Wahlen die 5 Prozent zu überbieten. Unter dem Strich ergab sich für die EDU so je ein Sitz im Bezirk Kulm und im Bezirk Zofingen.