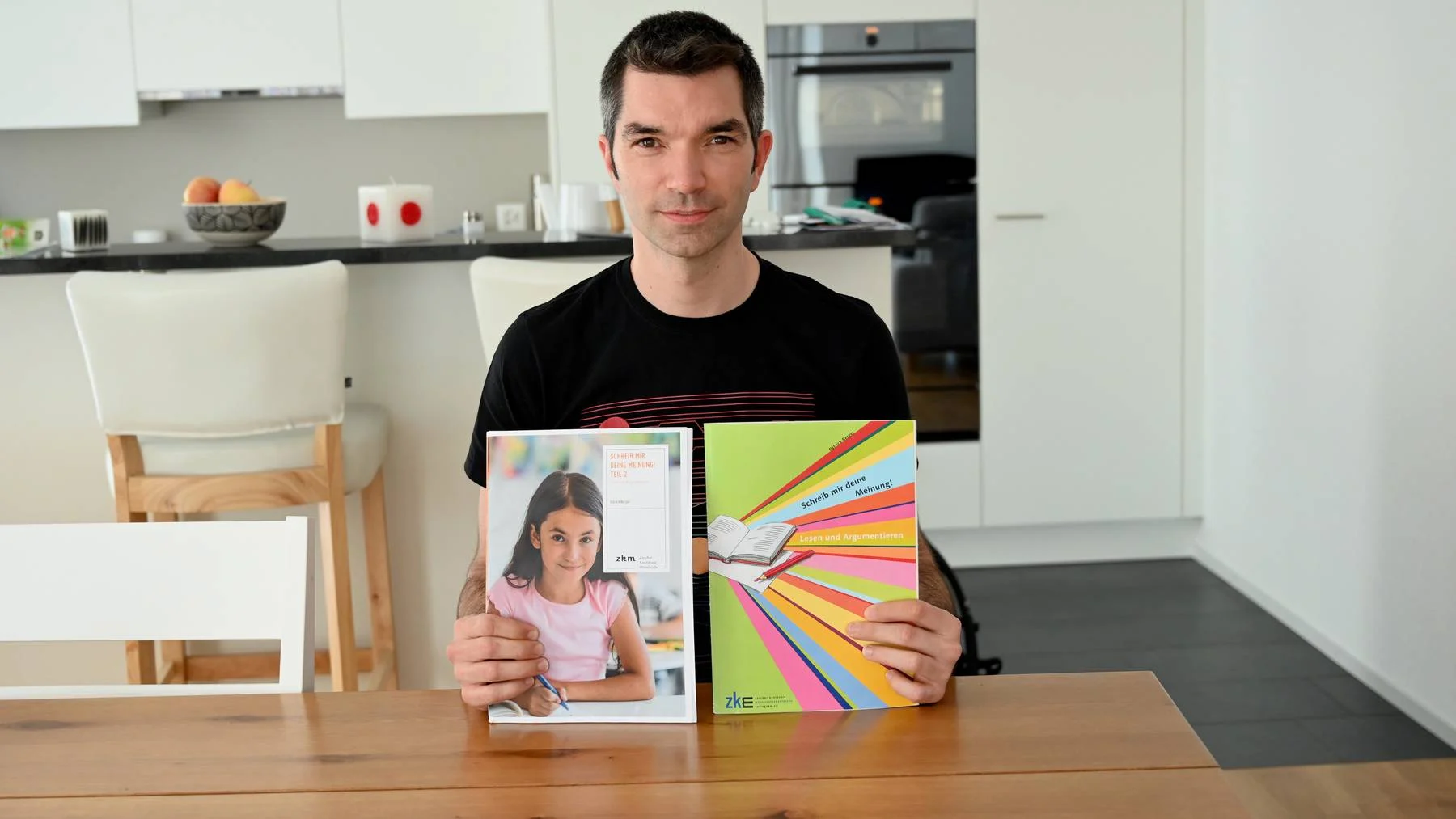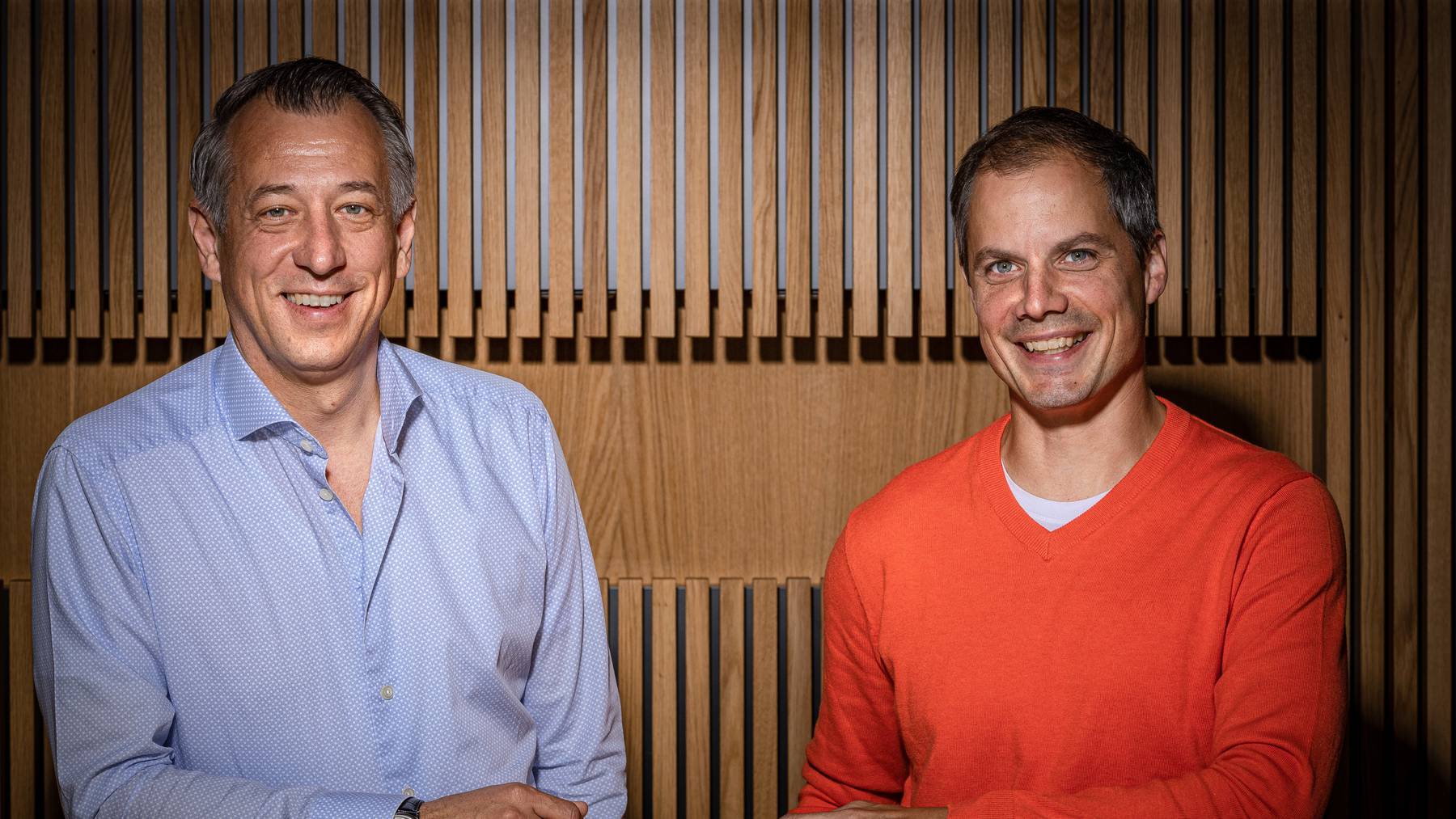Rudolf Strahm: «Eltern glauben, die Berufslehre sei eine Sackgasse»
Herr Strahm, KV Schweiz spricht von einem zweischneidigen Schwert, was die hohe Zahl an befristeten Anstellungsverhältnissen von Lehrabgängern anbelangt. Wie sehen Sie das?
Rudolf Strahm: Viele Unternehmen denken heute kurzfristiger und egoistischer. Früher war es Usanz, dass die Firmen die Lehrabgänger noch ein Jahr beschäftigten, um ihnen mehr Praxiserfahrung im Betrieb zu ermöglichen. Heute wollen viele Firmenchefs die Risiken der mangelnden Erfahrung, der Absenzen für die Rekrutenschule oder des baldigen Einstiegs in eine Weiterbildung nicht mehr tragen. Solches gilt aber nicht nur bei Absolventen von Berufslehren, sondern auch bei Uni-Abgängern. Die Hälfte der Universitätsabsolventen muss sich nach Studienabschluss auch mit kurzfristigen Einsätzen und Praktika begnügen, bevor sie später mit Berufserfahrung eine feste Anstellung erhalten.
Einerseits werden viele Lehrabgänger nur befristet angestellt, andererseits können die Unternehmen längst nicht alle offenen Lehrstellen besetzen. Ein Widerspruch?
Ja, das ist ein klassischer Widerspruch zwischen kurzfristigem Denken und langfristigem Interesse. In manchen Betrieben gibt es niemand in der Führung, der auf den langfristigen Unternehmenswert von eigenen, firmentreuen Fachkräften hinweist. Man denkt kurzfristig und sucht sich über Job-Portale dann Personal mit irgendwelchen Diplomen – häufig allerdings nicht mit grösserem Nutzen. In gewerblichen KMU allerdings, wo der Firmenchef noch die Berufsausbildung und Berufserfahrung wertschätzt, gibt es diese Hire-and-Fire-Politik nicht.
Warum haben die Unternehmen Mühe, ihre Lehrstellen zu besetzen?
Da ist mal die demografische Entwicklung: Jährlich gelangen derzeit etwa 1000 bis 1500 Jugendliche weniger ins Erwerbsalter. Das wird sich bald ändern. Hinzu kommt besonders in den städtischen Gebieten der Trend zum Gymnasium und die geringere Kenntnis und Wertschätzung der handwerklichen und berufspraktischen Arbeiten. Der gesellschaftliche Prestigetrend geht in Richtung «Büro» und «Digital» und weg vom Handwerk. Dabei wird übersehen, dass gerade in den technischen und innovativen Berufen die Informatik-Entwicklung eine zunehmend matchentscheidende Karrieremöglichkeit darstellt.
Hat die Berufslehre bei den Jugendlichen ein Imageproblem?
Ja, in den Städten mehr, in ländlichen Gebieten weniger. In städtischen Oberstufen haben die Lehrpersonen, die gemäss Lehrplan 21 ja auch das Fach «Berufliche Orientierung» oder «Berufswahlkunde» unterrichten müssten, zu wenig Kenntnis über die Bildungswege. Die Ausbildung von Lehrpersonen in den Pädagogischen Hochschulen (PH) wird gerade für dieses Fach vernachlässigt. Für dieses hätten die kantonalen Bildungsdirektoren längst die Leistungsaufträge an die PH anpassen müssen.
Müssen die Unternehmen mehr tun, um die Attraktivität der Lehre zu erhöhen?
Ja, ganz eindeutig. Firmenleiter mit langfristiger Perspektive tun das. Aber in grossen Konzernen sind 45 Prozent der Manager Ausländer, die das schweizerische Berufsbildungssystem nicht kennen und die erst noch ausländische HR-Leute und Personalchefs anstellen. Die Maschinenindustrie etwa im Raum Aargau allerdings gehört nicht in diese Kategorie der Ausbildungsminimalisten. Es gilt immer noch: Wer ausbildet, ist top und denkt langfristig!
Eltern sehen ihre Kinder vermehrt lieber in einem Gymnasium als in einer Berufslehre. Welche Gründe sehen Sie für den Trend hin zur Akademisierung in unserer Gesellschaft?
Die Medien und die Bildungselite sprechen dauernd von akademischen Bildungswegen, Uni-Karrieren, Erasmus und Spitzenforschung. Viele Eltern glauben, die Berufslehre sei eine Karriere-Sackgasse und sie pushen ihre Kinder auf den Weg ins Gymnasium. Sie kennen das durchlässige Bildungssystem nach dem Motto «Kein Abschluss ohne Anschluss» zu wenig, wie es seit zwei Jahrzehnten bei uns funktioniert: Wer eine Berufslehre absolviert, kann mit einer Berufsmaturität an die Fachhochschule oder mit einer Passerellenlösung an die Uni. Und wer später nach der Lehre Karriere machen will, kann mit zahlreichen Stufen der höheren Berufsbildung weiterkommen. Das sind heute zahlenmässig die begehrtesten Fachkräfte.
Die Durchlässigkeit unseres Berufsbildungssystems geniesst im In- und Ausland an sich einen guten Ruf. Dennoch scheint es als Argument für eine Berufslehre nicht mehr so stark zu stechen. Wie erklären Sie sich das?
Schon heute sind Fachkräfte mit einer Berufslehre plus Weiterbildung mit Fachhochschule oder mit Höherer Berufsbildung im Arbeitsmarkt mehr gefragt als Leute mit Uni-Abschlüssen. Wir haben zwar einen – selbst verursachten – Mangel an Ärzten, Informatikern und Ingenieuren. Aber wir haben gleichzeitig einen Überschuss an Uni-Abgängern in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, die danach zunehmend Mühe haben, in ihrem Beruf eine der Ausbildung adäquate Stelle zu finden. Sie glauben nicht, wie viele Universitätsabgänger nach dem Studium in Schwierigkeiten stecken, eine feste Anstellung zu finden. Ich sage voraus, dass dieser Trend noch zunehmen wird. Die Berufslehre plus höhere Weiterbildungen wird im Arbeitsmarkt an Wertschätzung weiter zulegen!