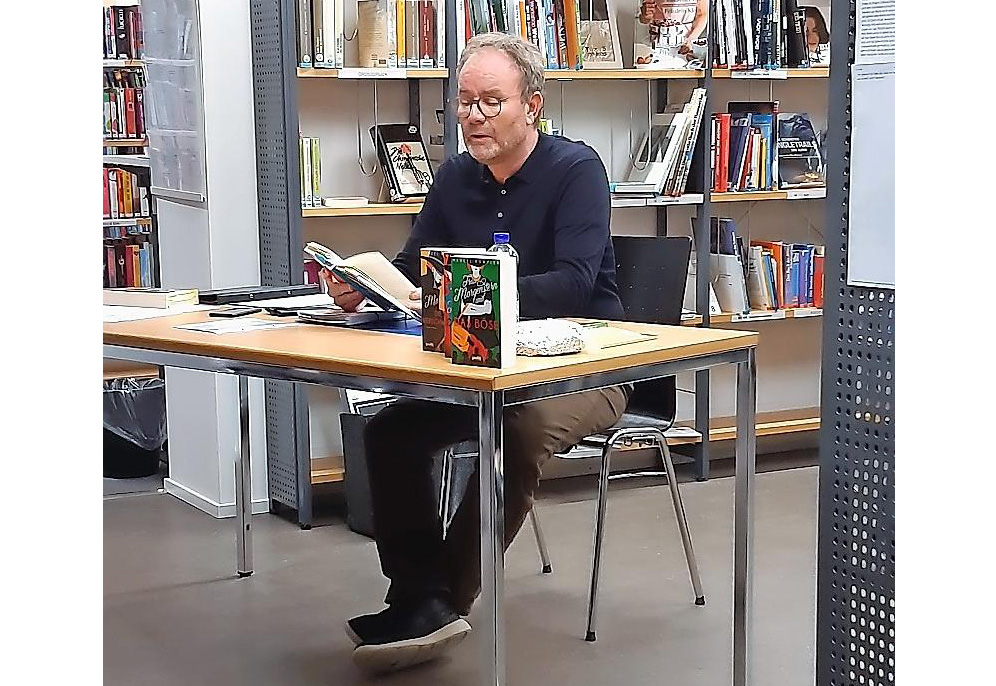Stoffe für die Ewigkeit – gewoben von Hand
Mehr als die Hälfte der Rothrister Familien lebten früher von der Weberei. Das zeigt eine Volkszählung aus dem Jahr 1798, in der auch die Berufe der Familienväter notiert sind. Die gelernte Textildesignerin Marianne Plüss aus Rothrist hält am Sonntag im Heimatmuseum Rothrist einen Vortrag zum Thema. Sie wird im Rahmen der Sonderausstellung «Altes Handwerk» erzählen, wie die Arbeit am Webstuhl damals aussah.
Weben als Heimarbeit
«Die Herstellung eines Kleidungsstücks war sehr aufwendig», sagt Marianne Plüss, deren Grossvater selbst als Weber arbeitete. Ein Händler, ein sogenannter Fergger, brachte den Heimarbeiter-Familien die Baumwolle, Wolle oder den Flachs nach Hause. Sie sponnen das Rohmaterial zu Garn und verwoben es am Webstuhl zu Stoffen. Der Fergger holte das fertige Gewebe ab, kontrollierte es, zahlte den Lohn und gab es an Fabrikanten in Zofingen und Aarau weiter. Die Stoffe wurden dort gefärbt, bedruckt und in die ganze Welt verschickt. Damit Garn und Gewebe nicht brüchig wurden, arbeiteten die Familien meist im Keller. Die feuchte Luft bewahrte das Material vor dem Austrocknen und Reissen. «Für die Menschen war das modrige Klima dagegen eher ungesund», fügt Plüss an. Das schlechte Licht hätte die Arbeit zusätzlich erschwert.
Bauern- und Handwerkerfamilien besassen fast immer einen Webstuhl. Sie produzierten Stoffe für den Eigengebrauch oder – wenn sie arm waren – im Nebenerwerb. Diese Stoffe bestanden meist aus Leinen. Dafür bauten sie Flachs auf dem Hof an; einer der Rohstoffe für das Leinen. Der Flachs, eine blau blühende, krautige Pflanze, musste gehegt und gepflegt werden. «Fiel die Ernte schlecht aus, gab es auch keinen Stoff für die Kleidung.» Nach rund vier Monaten waren die Pflanzen jeweils reif für die Ernte. Sie wurden samt Wurzeln aus dem Boden gerissen und in Bündeln zum Trocknen aufgehängt. Die Samenkapseln der Pflanze entfernte man anschliessend mit einem Riffelkamm; einem Gerät aus Holz oder Metall. Die Flachsstengel legte man danach auf einer Wiese aus, ehe sie über dem Feuer geröstet wurden. Danach folgte die «Brächete»: Mit einem Brechbock, eine hölzerne Vorrichtung, trennte man den harten Holzteil von den weichen Pflanzenfasern. Diese sponn man schliesslich zu Garn.
Putzlappen aus «Chuder»
«Nach diesen vielen Arbeitsschritten lag erst das Rohmaterial parat – das Weben des Stoffs und das Schneidern folgten erst noch», betont Marianne Plüss. Dabei konnten sich die armen Bauernfamilien keine Verschwendung leisten: Sie nutzten sogar den «Chuder», die minderwertigen Fasern, für die Stoffverarbeitung. Daraus machte man Sackleinen oder nähte Putzlappen. Aus dem hochwertigeren Leinenstoff schneiderten die Bäuerinnen Schürzen, Bettwäsche, Tisch- oder Handtücher. Die Ware diente oft als Aussteuer für die Töchter. Wohlhabende Familien gaben den jungen Frauen zusätzlich ein Spinnrad mit in die Ehe. «Man demonstrierte damit gerne Reichtum und Fleiss», weiss Marianne Plüss.
Der Leinenstoff hat eine natürliche, gräulich bis gelbliche Farbe. Gebleicht wurde mittels Rasenbleiche. Dazu legte man das Gewebe auf Wiesen am Wasser. Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und die Fotosynthese verursachten einen chemischen Bleichprozess. Das Färben des Materials übernahmen Färber. Vielerorts gab es aber Vorschriften, die es dem armen Volk untersagten, bunte Kleidung zu tragen.
Später kam fertiges, farbiges Garn auf den Markt. Die Bäuerinnen konnten damit einfache Streifen- und Karomuster weben. Bequem war die Kleidung allerdings nicht: Das Leinen war rau. «Es muss ziemlich auf der Haut gekratzt haben», glaubt Plüss. Dafür war das robuste Material schier ewig haltbar. Neue Kleidung war nicht so einfach erhältlich wie heute. Die Aussteuer sollte sogar ein ganzes Leben lang halten.
Das Handweben verlor mit der Industrialisierung an Bedeutung. Die Textilherstellung verlagerte sich über die Jahrhunderte ins Ausland. Die billigere Baumwolle löste das teure Leinengewebe ab. Heute geschieht die Textilproduktion meist in Billiglohnländern wie Bangladesch. Trotz moderner Technik sind noch immer viele Arbeitsschritte für die Produktion eines Kleidungsstücks notwendig. Es ist ein langer Weg vom Aussäen der Baumwollsamen bis zum Nähen des letzten Saums. «Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir heutzutage günstig Kleider einkaufen», sagt Marianne Plüss.