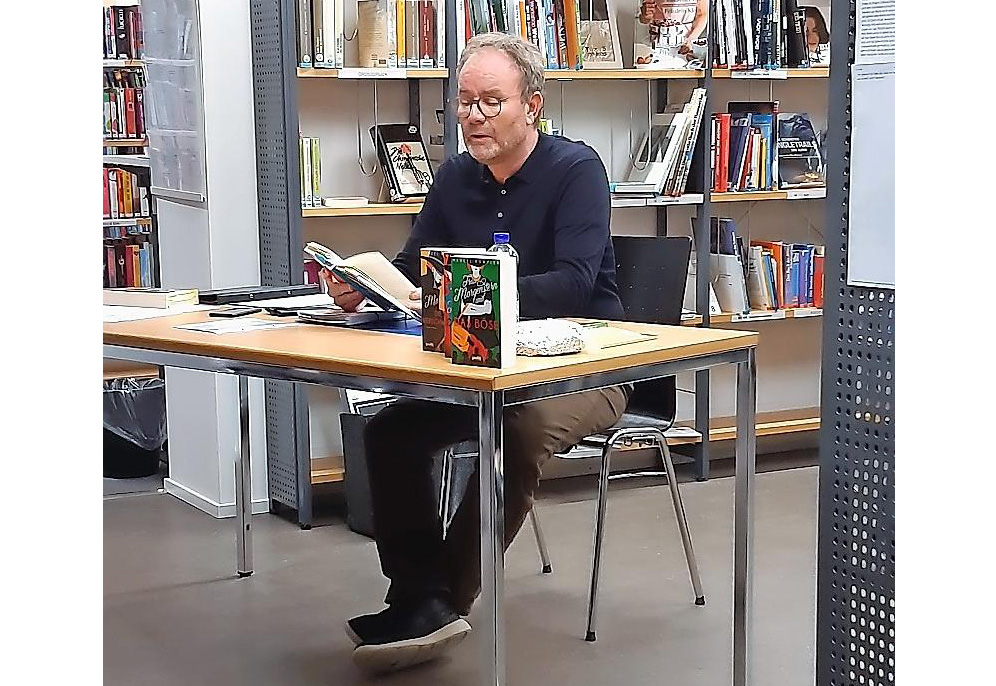Stromknappheit als Zukunftsszenario: Regensommer vermiest Produktion von Solarstrom
Der Sommer 2021 lässt sich in einem Wort zusammenfassen: verregnet. Nur allzu oft wurde nichts aus dem gemütlichen Feierabendschwumm in der Badi oder der Aare – und auch die Zeltferien fielen oft gehörig ins Wasser. Der verregnete Sommer wirkt sich aber nicht nur auf das Gemüt, sondern auch auf die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien aus.
Für Laufkraftwerke, wie etwa Ruppoldingen zwischen Rothrist und Boningen, bedeutet mehr Wasser nicht automatisch mehr Strom. Einerseits kann nur eine begrenzte Wassermasse durch die Turbinen gelassen werden – der Rest fliesst über das Wehr. Andererseits braucht zumindest Ruppoldingen einen gewissen Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser – also der Aare direkt vor und nach demWehr – zur Stromproduktion. Bei Hochwasser ist der Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser kleiner als normal. Dadurch sinkt die Stromproduktion in diesem Fall (wir berichteten).
Auch auf die Stromproduktion mit PV-Anlagen, also Solarstrom, hat der regnerische Sommer einen Einfluss. Dies zeigen Daten der EW Rothrist AG. Für diese Art der Stromproduktion sind vor allem die Monate April bis September wichtig. Bei vier repräsentativen Anlagen aus dem Versorgungsgebiet des EW Rothrist machten diese Monate im letzten Jahr rund 75 Prozent der jährlichen Stromproduktion aus. Im verregneten Juli wurden in diesem Jahr bei allen vier Anlagen weniger als 80 Prozent des Vorjahr-Stroms produziert.
Stromknappheit als Szenario in der Zukunft
Eine dieser Anlagen ist für eine Stromproduktion von 150 000 Kilowattstunden angedacht. «Das entspricht rund 30 Vierpersonenhaushalten», erklärt EW-Geschäftsführer Roberto Romano. 2020 produzierte die Anlage rund 172 000 Kilowattstunden – Strom für etwa 38 solcher Haushaltungen.
Betreffend Energie sieht Roberto Romano schwierige Jahre auf die Schweiz zukommen. Wenn die Atomkraftwerke tatsächlich wie aktuell geplant schrittweise abgeschaltet werden, wird die Bandenergie durch Atomkraft wegfallen. Gleichzeitig steigt aber der Bedarf, etwa durch den Umstieg auf Wärmepumpen oder die Elektromobilität.
Dann Strom zu importieren, wie es bei ungenügender heimischer Produktion aktuell getan wird, sei dann allenfalls nicht immer eine Lösung. Besonders dann nicht, wenn die umliegenden Länder ebenfalls keine Atomenergie mehr produzieren und vor ähnlichen Problemen stehen wie die Schweiz. «Es kann sein, dass wir dann auf uns gestellt sind und vielleicht etwas von unserem Komfort einbüssen müssen.» Beispielsweise könnten Wohnbereiche im Winter um ein Grad weniger warm geheizt werden, um so Strom zu sparen. «Das ist aber Politik und nicht unser Kerngeschäft. Bis es schliesslich so weit ist, vergeht noch viel Zeit, in der auch die Technologie weiterentwickelt wird.»
Autarke Häuserals Lösung?
Wäre denn unter diesen Umständen ein autarkes Haus eine Lösung? «Wir erkennen einen klaren Trend hin zu mehr Selbstständigkeit. Ohne grösseren Technologiesprung kann ich mir aber nicht vorstellen, dass autarke Häuser gross aufkommen.» Klar könne heute schnell etwas im Internet bestellt werden und eine autarke Stromversorgung töne verlockend. Interessierte sollten sich aber intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, so Romano. Denn autark sein bedeute auch, auf sich alleine gestellt zu sein, falls selbst nicht genug Strom produziert werden kann.