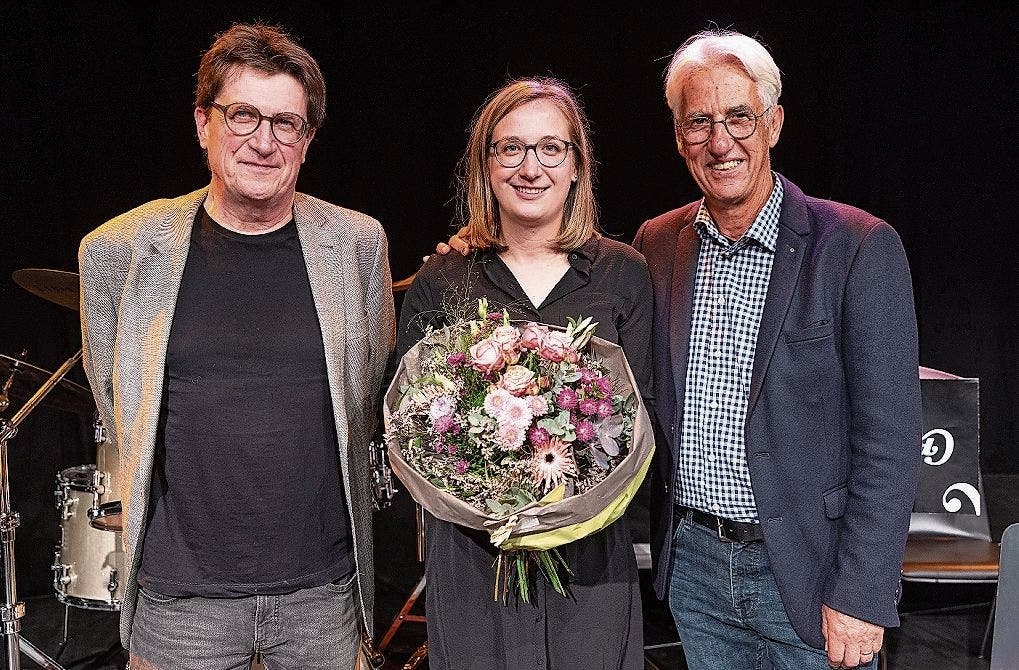Unzufrieden mit der Operation: 73-Jährige verlangte vom Kanton Solothurn eine halbe Million Franken
Die bald 73-jährige Frau C. (Kürzel erfunden) hat offenbar gleich doppeltes Pech mit ihrer rechten Hand: Im Jahr 1999 ging in einem Spital (das nicht zur soH gehört) eine Operation schief, was zu einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom führte. Im daraus resultierenden Haftpflichtfall kam es zu einem Vergleich, in dessen Rahmen der Frau schliesslich 800’000 Franken zugesprochen worden waren.
Am 2. April 2010 dann verletzte sich Frau C. bei einem Sturz wiederum an der rechten Hand. Wegen Schmerzen im Ringfinger, Schwellungen und Rötungen meldete sie sich acht Tage später in der Notfallstation des Kantonsspitals Olten (KSO). Am 13. April 2010 wurde sie von einem leitenden Arzt und einem Oberarzt operiert.
Erst ein Jahr später, im April 2011, machte Frau C. zunächst bei der Solothurner Spitäler AG und dann bei der Staatskanzlei des Kantons Solothurn Schadenersatz und Genugtuung geltend. Sie erklärte, dass sie sich schon am 3. Mai. 2010 wegen einer Infektion als Folge des KSO-Eingriffs in einem anderen Spital notfallmässig erneut habe operieren lassen müssen.
Bei Staatskanzlei und Verwaltungsgericht abgeblitzt
Nachdem das von Frau C. angestrengte Spitalhaftungsverfahren längere Zeit sistiert gewesen war, doppelte Frau C. im März 2015 mit konkreten finanziellen Forderungen nach. Dies begleitet von einem Privatgutachten und der Darstellung, dass ihre rechte Hand als Folge der Behandlung am KSO praktisch gänzlich unbrauchbar geworden sei. Was dann folgte, beschäftigte Experten, Beamte und Juristen über Jahre. Ein neues Gutachten lag in der Schlussfassung im Juli 2018 vor. Gestützt darauf wies die Staatskanzlei am 12. April 2019 das Gesuch um Schadenersatz und Genugtuung erstinstanzlich ab.
In der folgenden Beschwerde beim Solothurner Verwaltungsgericht verlangte Frau C. Schadenersatz für den bisherigen (197’685 Franken) und künftigen (225’807 Franken) Haushaltschaden, für ihre Gutachterkosten (9’350 Franken), die Anwaltskosten (17’289 Franken) sowie zudem eine Genugtuung (40’000 Franken) – alles in allem (mit Zinsen) eine Summe von über einer halben Million Franken. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde am 24. Juni 2020 ab.
Darauf gelangten Frau C. und ihr Anwalt ans Bundesgericht. In ihrer Beschwerde machten sie geltend, dass die Operation vom 13. April 2010 «gegen die Regeln der ärztlichen Kunst verstossen» habe, die postoperative Nachbehandlung widerrechtlich erfolgt sei – und dies erst noch ohne vorgängige Aufklärung.
Das Bundesgericht sieht keine Pflichtverletzungen
Vorwürfe, die bei der I. Zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts nicht verfingen. «Eine Pflichtverletzung ist nur dort gegeben, wo eine Diagnose, eine Therapie oder ein sonstiges ärztliches Vorgehen nach dem allgemeinen fachlichen Wissensstand nicht mehr als vertretbar erscheint und damit ausserhalb der objektiven ärztlichen Kunst steht», heisst es in den Erwägungen zum Urteil 4A_432/2020, publiziert am 5. Februar.
Das Bundesgericht stützt viel mehr die Würdigung des Verwaltungsgerichts, wonach in beiden vorliegenden Gutachten die gewählte Operationsmethode «als für diese Art Verletzung als geeignet» qualifiziert worden sei. Frau C. selbst habe – als sie sich am 30. April 2010 wegen einer Wundinfektion auf die KSO-Notfallstation begeben hatte, eine sofortige Operation verweigert. Die Folgen dieser Weigerung habe sie sich deshalb «selbst zuzuschreiben», und dass die Operationsdrähte zu spät aus der Wunde entfernt und der Infekt zu spät behandelt worden sei, könne deshalb nicht den behandelnden KSO-Ärzten vorgehalten werden. Dazu komme, dass Frau C. selbst «den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrochen» habe, indem sie sich zwischenzeitlich in einem anderen Spital habe operieren lassen.
Volle Invalidenrente – wirtschaftliche Existenz gesichert
Schon das Verwaltungsgericht hatte die finanziellen Forderungen von Frau C. zerpflückt: Die bald 73-Jährige erhalte seit dem 1. November 1993 eine ganze Invalidenrente und habe schon vor dem umstrittenen Eingriff eine halbe Hilflosenentschädigung bezogen. Folglich habe sie keine Nachteile durch eine Arbeitsunfähigkeit erlitten und ihr wirtschaftliches Fortkommen sei nicht erschwert worden. Ein Haushaltschaden sei zu verneinen, ebenso rechtfertige sich wegen der Unbeweglichkeit des Ringfingerendglieds keine Genugtuung. Auf die von Frau C. dagegen erhobenen Rügen trat das Bundesgericht nicht ein, «nachdem feststeht, dass die ärztlichen Handlungen mit Einwilligung der Beschwerdeführerin und nach den Regeln der Kunst erfolgten».
Das Bundesgericht wies die Beschwerde von Frau C. ab, soweit es überhaupt auf diese eintrat. Es brummte der Beschwerdeführerin nicht nur die Gerichtskosten von 8’000 Franken auf, sondern auch noch eine Entschädigung von 9’000 Franken an die Solothurner Spitäler AG für deren Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren.
Wenn der Staat haften soll
Verantwortlichkeitsgesetz
Laut kantonalem Verantwortlichkeitsgesetz haftet der Staat für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung amtlicher Tätigkeit jemandem widerrechtlich mit oder ohne Verschulden zufügt. Diese Bestimmung gilt auch für die Solothurner Spitäler AG soH und deren Personal. Nämlich konkret dann, wenn die ärztliche Sorgfaltspflicht tatsächlich verletzt worden ist. Eine Körperverletzung gibt der betroffenen Person Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit. Sofern ein Verschulden vorliegt, kann das Gericht auch eine Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
Wer sich durch eine Behandlung in einem der Spitäler der soH geschädigt glaubt, kann sein Schadenersatzbegehren bei der Solothurner Spitäler AG einreichen; dadurch wird die Verjährungsfrist unterbrochen. Das ermöglicht Verhandlungen zwischen dem Patienten und der soH. Kommt innerhalb von 3 Monaten keine Einigung zu Stande, überweist die soH das Begehren an die Staatskanzlei. Diese entscheidet – unabhängig und allein dem Recht verpflichtet – mit einer Verfügung. Wer mit deren Inhalt nicht einverstanden ist, kann innert zehn Tagen Beschwerde ans Verwaltungsgericht erheben. (ums.)