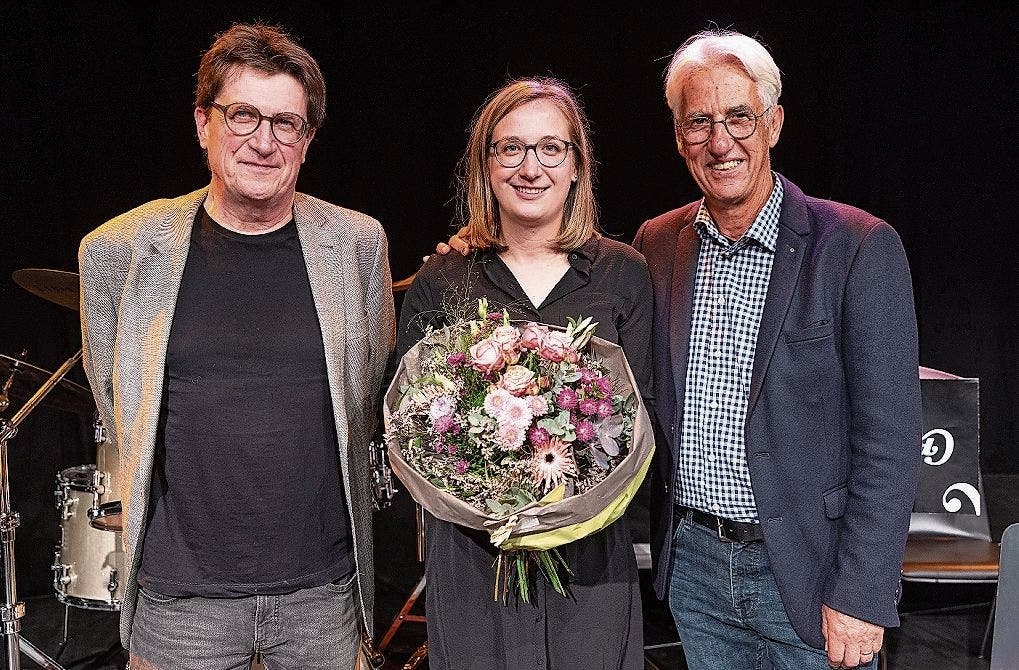Wieso ist der geplante Bahnhofplatz 50 Prozent teurer als noch vor drei Jahren?
Der neue Bahnhofplatz kostet rund 90 Millionen Franken, wie beim Start zur Mitwirkung vor zwei Wochen bekannt wurde. Bei einer Kostenbeteiligung von einem Viertel macht das für die Stadt Olten rund 22,5 Millionen Franken aus. Diese Zahlen sind indes noch mit einem Vorbehalt von ±30 Prozent behaftet. Das heisst, der neue Bahnhofplatz könnte gut und gerne auch 117 Millionen kosten, was den Anteil Oltens auf 29 Millionen steigert. Allerdings ist auch der umgekehrte Fall möglich: Das Projekt kostete dann noch 63 Millionen Franken.
Vor dreieinhalb Jahren sah es für die Stadt in finanzieller Hinsicht ähnlich aus: Damals sprach der Stadtrat anlässlich der Jahresmedienkonferenz Anfang 2016 in einer Mitteilung noch von Gesamtkosten von 60 Millionen Franken. Der Anteil Olten wäre damit auf 15 Millionen zu stehen gekommen.
Mehr ins Bauprojekt reingepackt
Wie kommt es, dass das Bauprojekt innert dreier Jahre um 30 Millionen, also um die Hälfte, teurer wird? Auf Anfrage heisst es bei der Stadt Olten, dass in den ersten Jahren der Projektbearbeitung «ein verkehrstechnisches Konzept» im Vordergrund stand. Dieses sei in der Zwischenzeit zu einem städtebaulichen Konzept weiterentwickelt worden, wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage schreibt. So wurden mehrere Elemente neu ins Projekt aufgenommen, die bisher nicht dabei waren. Dazu gehören etwa die Bahnhofzugänge, das neue Dach beim Eingangsbereich, welches dem Bahnhof eine neue Identität geben soll, oder die notwendigen Verkehrsmassnahmen während der rund dreijährigen Bauzeit. Zudem ist die geplante Veloabstellanlage vergrössert worden: Statt 1000 Plätze sind nun sogar deren 1250 vorgesehen.
Bereits Ende 2016 wurde von den Projektverantwortlichen denn auch signalisiert, dass eine Phase der Kostenoptimierung eingeleitet worden sei, nachdem die Gesamtkosten für den neuen Bahnhofplatz aufgrund von Projektpräzisierungen und -erweiterungen von den ursprünglich berechneten Beträgen abwichen, schreibt Dietler weiter. Zwar sei ein gewisses Einsparpotenzial festgestellt worden, nachträglich sei aber die aufwendigere Dachlösung hinzugekommen. «Wir sind nun bei einem Stand angelangt, wo alle möglichen Kosten mit der erwähnten Bandbreite von ±30 Prozent berücksichtigt sein sollten», sagt Dietler auf Anfrage. Ausser, es käme bei der derzeit laufenden Mitwirkung noch Weiteres hinzu.
Keine projektbezogenen Steuererhöhungen mehr
Im bisherigen Finanzplan waren für den Bahnhofplatz 10,65 Millionen Franken vorgesehen. Im neuen Finanzplan 2020 bis 2026 sind es insgesamt 14,4 Millionen Franken. Die beiden Jahren 2027 und 2028, wenn das Projekt im Bau steht, fehlen aber noch. «Gerade in den letzten Baujahren fallen erfahrungsgemäss die meisten Rechnungen an», sagt Dietler. Interessant ist der Blick auf die vom Stadtrat festgelegte Entwicklung des Steuerfusses. Bisher ging die Oltner Regierung davon aus, dass wegen der drei grösseren Projekte Bahnhofplatz, neues Schulhaus Kleinholz und Stadtteilverbindung Hammer eine Steuererhöhung nötig würde. Gemäss letztjährigem Finanzplan sollten die Steuern im Jahr 2021 beim Baustart des Schulhauses auf 115 Prozent steigen (von bereits erhöhten 112 Prozent), beim Baustart des neuen Bahnhofplatzes im Jahr 2023 nochmals um 3 Punkte auf 118 Prozent.
Stadtteilverbindung soll Stadt noch 1 Million kosten
Davon will der Stadtrat nun nichts mehr wissen – trotz höherem Kostenanteil der Stadt am neuen Bahnhofplatz. Eine Steuererhöhung ist zwar noch aufs Jahr 2021 geplant – und zwar um 4 Punkte auf 112 Prozent. Danach gibt es aber keine Anpassungen mehr. Der Grund dafür ist, dass das dritte grössere Projekt, die Stadtteilverbindung Hammer, die Stadt netto nur noch eine Million Franken kosten soll. Der Stadtrat möchte die Verbindung zum neuen Quartier via neues Planungsausgleichsgesetz finanzieren: Von den Bruttokosten von
20 Millionen soll neben einem Beitrag aus dem Agglomerationsfonds der Hauptanteil vom Eigentümer kommen. Dies, weil der hintere Teil des Olten-SüdWest-Areals noch von der Industrie- in die Wohnzone umgezont werden muss. Bisher hatte die Areal-Besitzerin, die Terrana AG Rüschlikon mit ihrem Vertreter Sigmund Bachmann, zugesichert, 2,5 Millionen Franken an die Langsamverkehrsverbindung zu zahlen.