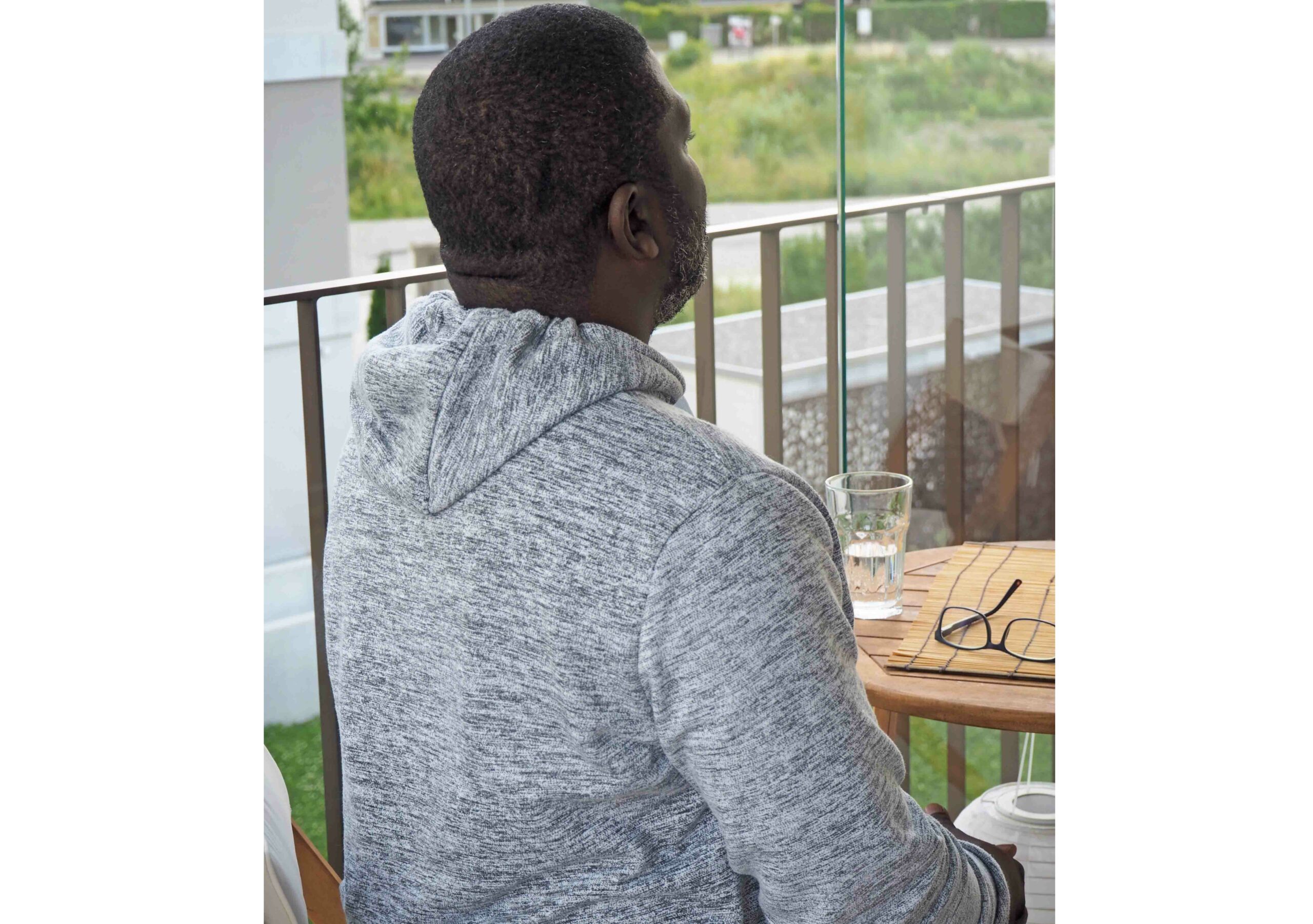Deutsche Pfarrerin Dörte Gebhard: «Ich schaue mit Besorgnis auf Europa»
Wie schwer fiel Ihnen die Entscheidung, in die Schweiz zu ziehen?
Dörte Gebhard: Überhaupt nicht schwer. Das liegt vor allem daran, dass ich Pfarrerin bin. Wenn man in eine Gemeinde kommt, hat man automatisch viele Kontakte. Ich arbeite mitten unter sehr unterschiedlichen Menschen, von den Grünen bis zur SVP. Aus beruflichen Gründen habe ich Zugang zu allen gesellschaftlichen Milieus.
Was ist mit Ihrer Familie?
Im Gegensatz zu meinem Mann, der eine grössere Familie in der Schweiz hat, habe ich in Deutschland fast keine Familienmitglieder mehr. Ich stamme ohnehin aus einer sehr kleinen Familie. Dementsprechend verbringen wir ein- bis zweimal jährlich ein paar Tage in Deutschland, um beispielsweise meinen Bruder oder Freunde zu besuchen. Wobei die meisten gerne in die Schweiz kommen, um hier Ferien zu machen (lacht).
Sie sind aufgrund der Liebe hier?
Genau, ich habe meinen Mann an einer internationalen Tagung auf dem Leuenberg bei Basel kennengelernt. Er war damals Pfarrer im Bündnerland und ich wohnte in Kiel. Anfangs pendelten wir hin und her, sehr bald entschieden wir uns für einen gemeinsamen Wohnsitz in Bonn.
Ich nehme an, das war für Sie einfacher, da Sie in dem Moment nicht Ihr Heimatland verlassen mussten.
Nein, es war für uns beide dort relativ fremd. Der Unterschied zwischen den Mentalitäten, die in den einzelnen Regionen Deutschlands herrschen, ist zum Teil weitaus grösser als der Unterschied zur Schweiz.
Unterscheiden sich Deutschland und die Schweiz demnach nicht?
Nicht sehr. Ich denke wirklich, dass sich aus historischen Gründen Ost- und Westdeutschland, aber auch der Süden und der Norden mindestens so stark unterscheiden wie Deutschland und die Schweiz. So ist Zofingen als Kleinstadt meinem Geburtsort Parchim viel ähnlicher als die Grossstadt Bonn.
Wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
Darüber halte ich meistens einstündige Vorträge. (lacht)
Und die Kurzfassung?
Ich war 17 Jahre alt und habe damals an alles Mögliche gedacht, was zum Normalprogramm mit 17 gehört: Beruf, Studium, Liebe. Die eigentliche Nacht vom 9. November 1989 habe ich verschlafen. Erst am nächsten Morgen habe ich vom Mauerfall gehört und realisiert, was geschehen ist. Meine erste Reaktion war absolute Fassungslosigkeit. Am Freitag, 10. November, ging ich noch normal zur Schule. Am Samstag fuhren wir in den «Westen». Ich kroch durch ein eilig aufgebrochenes Loch in der Mauer nach Berlin-Kreuzberg.
Was war Ihr erster Eindruck?
Ich war eher abgeschreckt und dachte nicht, dass es toll wäre, so zu leben. Die Auseinandersetzung mit der neuen Welt und der Gesellschaft dauerte eine ganze Weile. Der Mauerfall war sicherlich das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben. Dagegen war der Umzug in die Schweiz völliger Pipifax! (lacht)
Könnten Sie sich vorstellen, wieder in Deutschland zu leben?
Ich könnte mir vorstellen, in vielen anderen Ländern der Welt zu leben. Aber im Moment gibt es für mich keinen Grund, über eine solche Veränderung nachzudenken.
Wie nahe sind Sie noch an der deutschen Politik?
Ziemlich nahe, dank meiner Zeitungslektüre.
Wie schätzen Sie die Entwicklung, insbesondere der Alternative für Deutschland (AfD), ein?
Obwohl auch die SVP problematische Ziele verfolgt, steht die AfD wesentlich weiter rechts. Ich schaue aber mit grosser Besorgnis auf ganz Europa, weil die Nationalismen vielerorts zunehmen, beispielsweise in Ungarn oder Polen.
Versuchen Sie, mit Ihrer Stimme an Wahlen etwas dagegen zu tun?
Vor einigen Jahren wurde ich eingebürgert und nehme hier selbstverständlich an allen Wahlen und Abstimmungen teil. Anders sieht es in Deutschland aus. Als sogenannte «Auslandsdeutsche» darf ich offiziell nur wählen, wenn ich «unmittelbar und persönlich vertraut mit den politischen Verhältnissen bin». Da ich diese Anforderung nicht erfülle, stelle ich keine Anträge auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis. Die regelmässige Lektüre einer deutschen Wochenzeitung führt nicht zu einer ausreichenden Kenntnis der Parteien und Kandidaten.
Hatten Sie in der Schweiz Begegnungen, die nicht besonders erfreulich waren?
Nein, eine überwältigende Mehrheit nimmt einen hier freundlich auf.
Und was ist mit dem Rest?
Ich erinnere mich an vereinzelte Situationen, in denen ich beispielsweise in einem Laden offensichtlich wie Luft behandelt wurde, weil ich nicht Mundart sprach. Aber das ist wirklich keine grosse Geschichte wert, weil unzählige andere Begegnungen völlig normal waren.
Sie sind seit 2007 in der Schweiz. Wieso sprechen Sie keine Mundart?
Das werde ich ab und an gefragt. Ich antworte dann immer gleich. Wenn ich nach Bayern gezogen wäre, hätte ich auch nicht plötzlich Bayerisch gesprochen. Das wäre mir sonderbar vorgekommen. Ich möchte doch hören, von wo jeder Mensch kommt. Das ist das Interessante. Also spreche ich auch hier den Dialekt, mit dem ich aufgewachsen bin.
Ausnahmslos?
Ich wechsle nur dann auf Mundart, wenn es die Situation verlangt. Zum Beispiel, wenn eine betagte Person am Ende ihrer Kräfte ist und ich das Gefühl habe, dass er oder sie mein Hochdeutsch schlecht versteht. Dann spreche ich so Mundart, wie ich es kann.
Welche Vorurteile hatten Sie gegenüber der Schweiz?
Eine deutsche Bekannte sagte mir, ich solle mich auf die Schweiz freuen, das Land sei sozusagen der «Vorhof des Paradieses». Auch der gute öffentliche Verkehr, die Ordnung und die Vielsprachigkeit sind Aspekte, die in Deutschland sehr positiv bewertet werden.
Also sind Sie glücklich in der Schweiz?
Ja. Ausserdem habe ich durch die Theologie gelernt, dass es viel besser ist, sich einen Vorrat an positiven Erinnerungen anzueignen, mit dem man älter werden kann. Das Gleiche gilt, wenn man in ein anderes Land zieht. Wenn man auf das Negative fokussiert ist, kann man kaum glücklich werden.
Zur Person
Dörte Gebhard (47) wuchs in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie studierte Theologie und arbeitete schon in verschiedenen Teilen Deutschlands an der Universität und im Pfarramt. Im Jahr 2000 heiratete sie Ruedi Gebhard, der heute Zofingens Pfarrer ist. 2007 zogen sie nach Kölliken. Dörte Gebhard ist seit 2010 Privatdozentin für Praktische Theologie an der Universität Zürich und trat 2012 eine Teilzeitpfarrstelle in Schöftland an. Seit dem 1. August 2019 lebt Familie Gebhard mit ihren zwei Kindern in Zofingen.
«Achtung, fertig, Vorurteile» – Das sagt Dörte Gebhard zu den gängigen Vorurteilen gegenüber Deutschen
Die Deutschen sind direkt.
Das stimmt, aber die Schweizer auch. Nur auf eine völlig andere Weise. Man muss lernen, die Zeichen richtig zu deuten. Wenn sie sagen «Ich bin irritiert!», sind sie eigentlich schon auf 180. Wenn Deutsche direkt sind, meinen sie es manchmal gar nicht so streng, wie es rüberkommt, etwa wenn einer sagt «Ich krieg’ ein Bier!»
Die Deutschen tragen gerne Sandalen mit weissen Socken.
Das scheint neuerdings wieder Mode zu werden, wenn ich bei meinen Kindern schaue. Ein paar Jahre lang ist mir überhaupt niemand mit Socken in Sandalen aufgefallen, schon gar nicht in weissen. Ich glaube, das gibt es eher auf dem gestellten Foto als in der Realität.
Die Deutschen sind humorlos.
Das stimmt gar nicht. Wir haben Humor, aber einen ganz anderen. Ich liebe den deutschen Humor sehr, wobei sich auch der Humor in Deutschland je nach Region wieder unterscheidet.
Die Deutschen trinken viel Bier und essen am liebsten Sauerkraut mit Wurst.
Sauerkraut habe ich persönlich sehr gerne, gehöre aber zur Minderheit. Bier trinkt man in Deutschland traditionell dort, wo aus klimatischen Gründen kein Wein wächst. In den Weinregionen wird natürlich Wein getrunken.
Die Deutschen sind pünktlich.
Ich hoffe es von ganzem Herzen (lacht). Denn so besteht die Möglichkeit, sich auf etwas oder jemanden zu verlassen. Aber auch hier habe ich unterschiedliche Erfahrungen in den verschiedenen Gegenden Deutschlands gemacht. Ich fand die Rheinländer immer eher unpünktlich.
Die Deutschen fallen im Urlaub häufig auf.
Ich weiss es nicht. Ich bin wahrscheinlich zu individualtouristisch, um diese Frage zu beantworten. Wir fahren häufig nach Skandinavien in die Ferien. Dort würde ich nicht sagen, dass die Deutschen extrem auffallen.
Die Deutschen verbringen ihre Ferien gerne auf Malle.
Offenbar. Aber da kann ich nicht mitreden, weil ich selber noch nie da war. Wie das zu dem «17. Bundesland» werden konnte, ist mir nicht klar.
Die Deutschen haben Mühe, Fremdsprachen zu sprechen.
Wir tun es mit einem unverwechselbaren und anstrengenden Akzent. Wir lernen schon Französisch, aber so, dass sich mein Mann schlapplacht und er 100 Meter gegen den Wind hört, dass man in Wirklichkeit Norddeutsche ist. Die französische Betonung können wir wohl nie perfektionieren. Dasselbe gilt auch für Englisch und ein paar weitere Sprachen.
Die Deutschen bauen die besten Autos.
Ach du liebe Zeit, sicher nicht (lacht). Das ist leider ein gründlich widerlegtes Vorurteil, wenn man sieht, was sich für Skandale in der letzten Zeit zugetragen haben. Es wäre schön, wenn man von den Deutschen bald wieder sagen könnte, dass sie innovativ sind, was Fortbewegungsmittel angeht.
Die Deutschen spielen gut Fussball.
Nein, auch das stimmt nicht. Die Deutschen hielten sich nach der Wende für unbesiegbar, aber das hat sich sehr schnell gelegt. Ich glaube, es ist besser, wenn abwechslungsweise immer jemand anderes gewinnt.