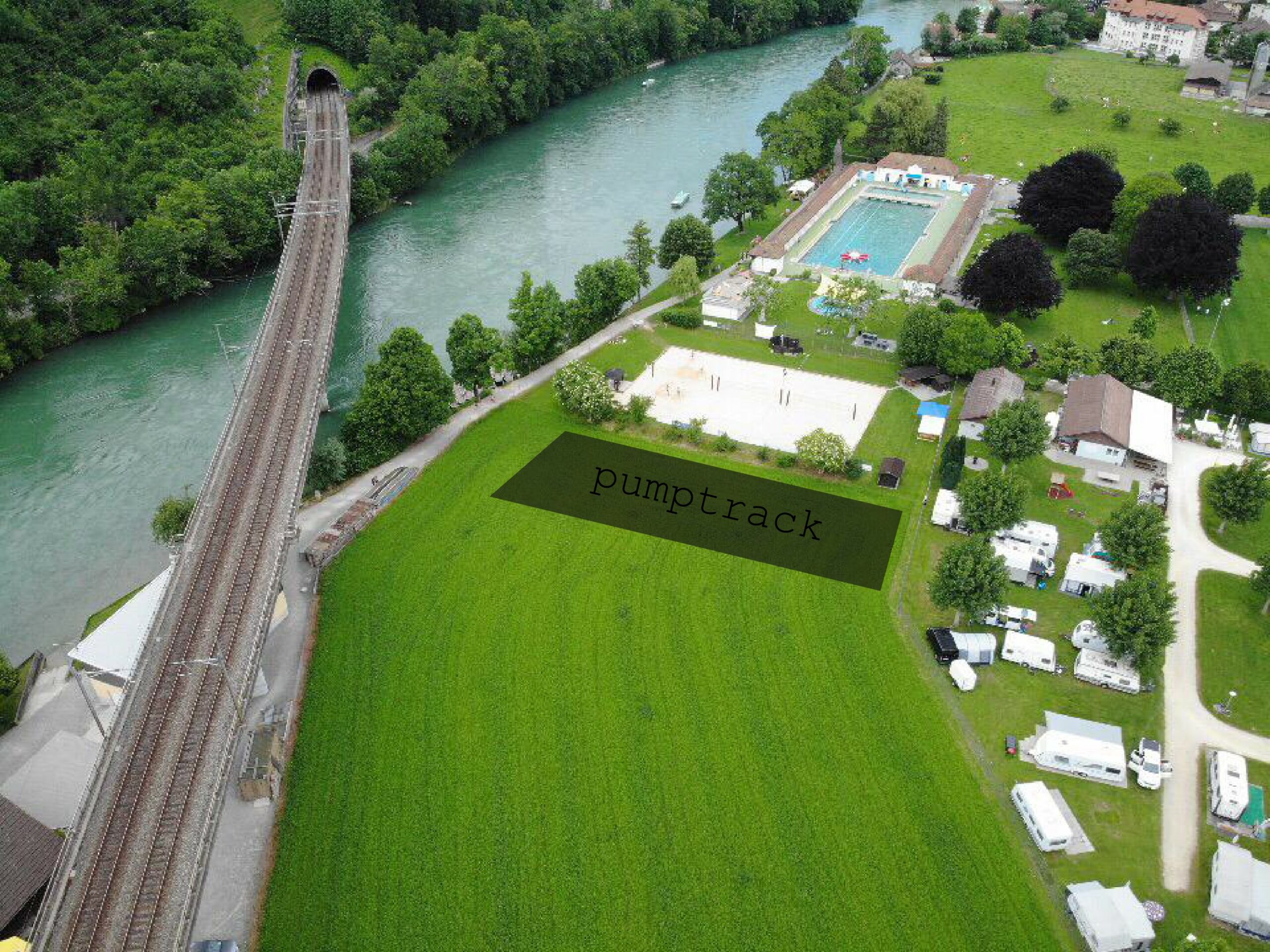Spezielle Förderung: In Aarburg wird der Deutschunterricht für Fremdsprachige zur «Insel»
Bahareh und Feven sind beide 16 Jahre alt. Die Afghanin und die Eritreerin besuchen regelmässig eine Insel. Dabei handelt es sich um die Deutsch-Insel im Schulhaus Paradiesli in Aarburg, die von Lehrerin Melanie Baumann ins Leben gerufen wurde. Freundlich und in korrektem Deutsch begrüssen sie die Journalistin und begleiten diese in das Schulzimmer, wo die anderen fremdsprachigen Jugendlichen warten.
Hintergrund: Im letzten Jahr hat der Kanton Aargau die sogenannte Neuressourcierung lanciert. Die Schulen erhalten neu ein Ressourcenkontingent, mit dem sie – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der Bildungsrechte der Schülerinnen und Schüler – ein angemessenes, sachgerechtes und möglichst wirkungsvolles Schulangebot bereitstellen. An der Oberstufe in Aarburg (Sek und Real) sind zwei Projekte lanciert worden: die Deutsch-Insel für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache sowie das Berufswahlbüro, wo von René Steiner schulintern Berufsberatung angeboten wird.
Verschiedene Lernniveaus sind herausfordernd
Inzwischen haben Bahareh und Feven Platz genommen. Die Klasse ist an diesem Nachmittag in zwei Gruppen unterteilt. Die Lernniveaus der Jugendlichen sind unterschiedlich. Das ist auch für Lehrerin Melanie Baumann eine Herausforderung. Während man sich in der grösseren Gruppe über besondere Anlässe in ihrer Kultur unterhält, üben zwei Buben erste Fragen auf Deutsch. Beide sind noch nicht lange in der Schweiz.
Im Leitbild der Schule Aarburg ist Deutschförderung enthalten. Die Gemeinde hat bekanntlich sehr viele Kinder mit anderer Muttersprache. «Die Einschulung der Kinder solcher Familien stellt eine Herausforderung dar für die Lehrpersonen, für die Mitschülerinnen und Mitschüler und natürlich auch für die betroffenen Kinder selbst», schreibt Melanie Baumann in ihrem Konzept. Die Deutsch-Insel ersetzt den Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht, der mit der Neuressourcierung entfällt. Die Deutsch-Insel ist täglich während zwei bis drei Lektionen offen. «Je nach Sprachkenntnissen besuchen die Kinder jede Lektion oder dann weniger», erklärt Melanie Baumann. Derzeit besuchen 13 Jugendliche regelmässig den Unterricht bei ihr. Vom Hören über das Sprechen bis hin zum Lesen und Schreiben werden die Deutschkenntnisse in Schrittchen erweitert und geübt. Die Lehrperson plant so, dass sie in jeder Fokusstunde etwas Neues vermittelt, was hörend sowie sprechend vertieft wird. «Ziel ist es, möglichst rasch eine Basis zu schaffen, die es den Schülerinnen und Schülern erlauben sollte, anderen Schulfächern folgen zu können», heisst es im Konzept.
Es sei nicht ganz einfach gewesen, die Deutsch-Insel in den Stundenplan zu integrieren, sagt Baumann. Die Unterrichtsstunden bei ihr finden dann statt, wenn die anderen Jugendlichen die Fächer Deutsch oder Realien besuchen. Baumann war lange tätig als Reallehrerin und Klassenlehrperson, nun fokussiert sie sich auf den Deutsch- und Englischunterricht. «Als ehemalige Klassenlehrperson weiss ich, welche Bedürfnisse die Lehrpersonen in Bezug auf fremdsprachige Kinder haben», sagt sie. «Kinder, welche die Sprache nicht beherrschen, können zu Unruheherden in der Klasse werden.» Entsprechend seien die Rückmeldungen auf die Deutsch-Insel sehr positiv ausgefallen. Das Konzept bringe Ruhe in die Situation. Es sei entlastend für die Kinder, aber auch für die Lehrpersonen.
Berufliche Integration ist ein Grundpfeiler
Zeitlich sei die Deutsch-Insel eine Herausforderung, ergänzt Baumann. Sie hat bereits nach mehr Ressourcen gefragt. Eine weitere Schwierigkeit sei der unterschiedliche Bildungsstand der Jugendlichen. Baumann unterrichtet die Schülerinnen und Schüler nicht nur in Deutsch, sondern vermittelt ihnen auch Lernstrategien. Sie will ihnen Werkzeuge mitgeben, um die Sprache einfacher zu lernen. Und auch bezüglich Integration in die Berufsausbildung vermittelt sie, indem sie den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern das Schul- und Berufsbildungssystem der Schweiz näherbringt. Dabei arbeitet Baumann eng mit René Steiner zusammen, der die schulinterne Berufsberatung unter sich hat.
Die berufliche Integration ist ein Grundpfeiler der Schule. Der Bedarf ist da, wie René Steiner sagt. Aktuell hat ein Drittel der Aarburger Oberstufenschülerinnen und -schüler noch keine Anschlusslösung. Hier kommt René Steiner zum Einsatz. Bei ihm können die Jugendlichen Termine buchen und sich beraten, coachen und begleiten lassen. Hin und wieder werden auch die Eltern miteinbezogen. Dass das wichtig ist, zeigt die Erfahrung von Steiner. «Es gibt Eltern aus anderen Ländern, die meinen, dass ihr Kind nach der Schule studieren kann», erzählt er. «Hier muss ich aufklären, wie das System bei uns funktioniert.» Einige Eltern seien dann frustriert.
Die Coronapandemie hat René Steiners Aufgabe ebenfalls erschwert. Einerseits sei es für die Jugendlichen schwierig geworden, eine Schnupperlehrstelle zu finden, andererseits hätten verschiedene Anlässe nicht durchgeführt werden können. Und: «Es gibt zwar offene Lehrstellen, aber es werden aufgrund der Krise wohl nicht alle besetzt.» Unter den Schülerinnen und Schülern hat sich die erfolgreiche Arbeit von René Steiner längst herumgesprochen. Darum sind die Termine bei ihm beliebt, denn er pflegt gute Kontakte zu den verschiedensten Lehrmeistern. Davon können die Aarburger Jugendlichen profitieren.
Frühförderung Deutsch durch Kanton nicht berücksichtigt
Im Frühling lancierte der Kanton Aargau das Pilotprojekt «Deutschförderung vor dem Kindergarten». Interessierte Gemeinden konnten sich beim Kanton melden. Aarburg mit einem Ausländeranteil von über 43 Prozent schien wie prädestiniert für dieses Projekt. So haben 80 Prozent der Aarburger Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund, ihre Muttersprache ist also nicht Deutsch. Umso wichtiger, dass Kinder bereits beim Kindergarteneintritt Deutsch sprechen. «Alle Beteiligten gingen mit grossem Elan an die Ausarbeitung der Piloteingabe», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Auch die ansässige Kita und die Spielgruppe konnten an Bord geholt werden. Alle seien davon ausgegangen, dass die Chancen sehr gross sind, um am Projekt teilnehmen zu dürfen. «Leider war dem aber nicht so, der Kanton hat sich für vier andere Gemeinden sowie einen Gemeindeverband entschieden – Aarburg geht leer aus», teilt der Gemeinderat mit. «Alle Beteiligten können den Entscheid nur schwer nachvollziehen, da fast keine andere Gemeinde im Kanton die Voraussetzungen besser erfüllt.» Ob Aarburg das Projekt auch ohne Unterstützung des Kantons stemmen kann, wird abgeklärt. Auf Anfrage sagt die zuständige Frau Vizeammann Martina Bircher, dass die Kostenabklärung noch gemacht werden muss. (jam)