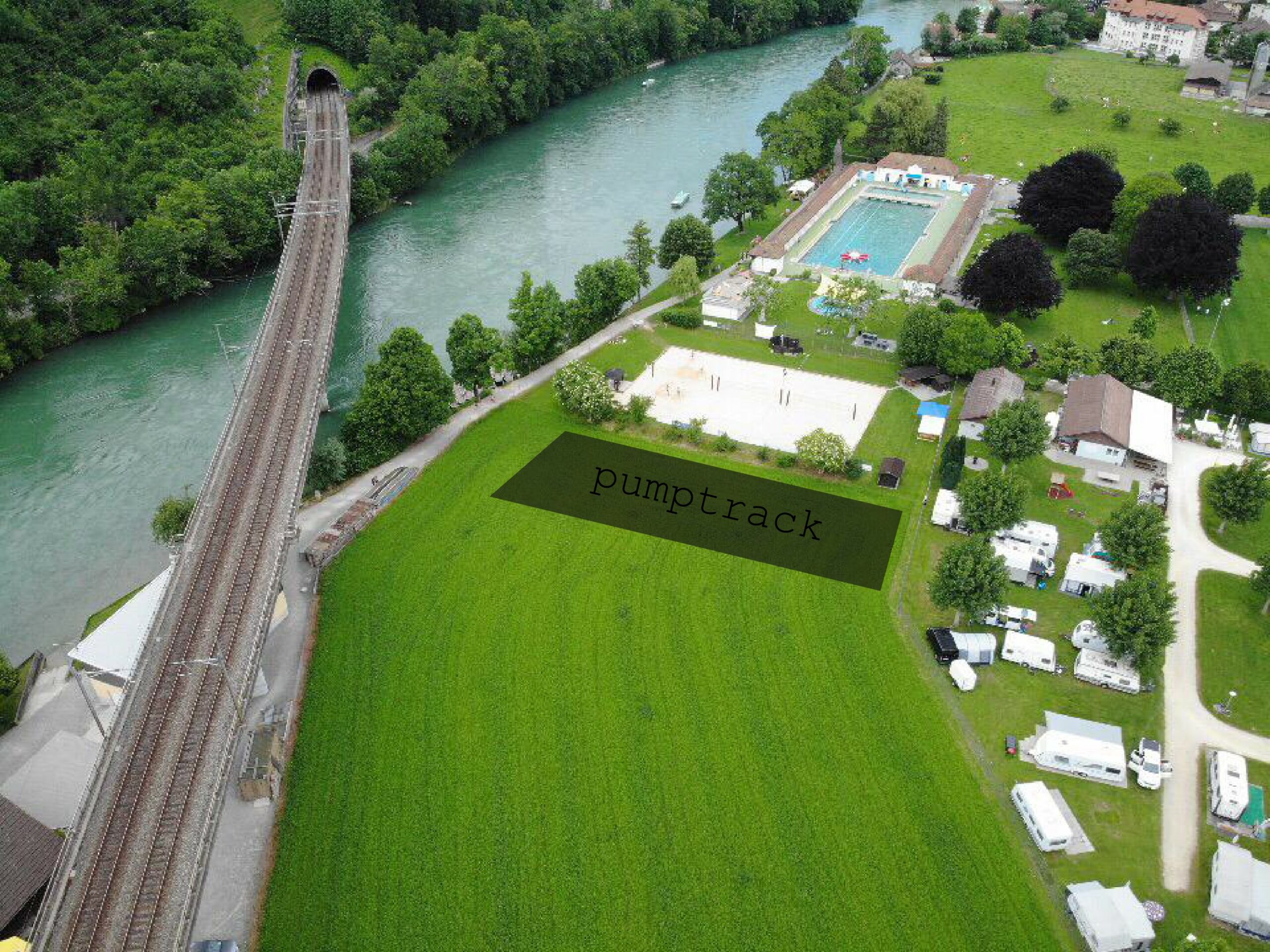Der grösste Kredit in der Geschichte der ARA Aarburg

Becken reiht sich an Becken. In ihnen blubbert Wasser, welches allerdings nicht wirklich einladend aussieht. Eine braune Brühe, die zudem ziemlich streng riecht. «Die Reinigungsprozesse verlaufen einwandfrei – auch dieses Wasser wird schon bald sauber sein», versichert Erich Schnyder. Der 70-jährige Aarburger weiss, wovon er spricht. Er ist seit 30 Jahren Geschäftsführer der Vorzeigeanlage in unmittelbarer Nähe zur Autobahnein-/ausfahrt Rothrist. Ein letztes Ausbauprojekt will Schnyder noch durchziehen, bevor er sich Ende 2024 auch von dieser Aufgabe verabschieden will.
Am 15. September werden die Abgeordneten des Abwasserverbands Aarburg über den grössten Kreditantrag in der Geschichte der ARA entscheiden: 19,9 Millionen Franken sollen für die Erweiterung der Biologie bewilligt werden. Stimmen die Abgeordneten dem Projekt zu, soll die Inbetriebnahme im Herbst 2023 erfolgen – und das Projekt bis Mitte 2024 abgeschlossen sein.
Durch Zufall zum Abwasser gekommen
Dreissig Jahre sind eine lange Zeit. «Nein, geplant war das überhaupt nicht», sagt Schnyder und lacht. Er sei 1988 zufällig zum Abwasser gekommen – als Vertreter des Gemeinderates Aarburg von Amtes wegen in den Vorstand der ARA gewählt worden. «Und dann habe ich ein Jahr lang nichts gesagt», erinnert sich Schnyder schmunzelnd, «bevor ich mich an einer Vorstandssitzung sehr ungehalten über die Verbandsführung äusserte, weil ich dringenden Handlungsbedarf sah.» Seine Hauptkritikpunkte damals: Nach dem Abgang des damaligen Betriebsleiters Emil Bachmann fehlte es an Führung und es gab keine Finanzplanung. Für den Betriebswirtschafter Schnyder ein absolutes No-Go. Sein erster Vorschlag, eine gemeinsame Geschäftsführung für die ARA Oftringen und die ARA Aarburg zu installieren, sei 1989 nicht zustande gekommen. In Aarburg wurde 1990 dafür eine Betriebskommission eingesetzt, die in der Folge von Erich Schnyder geführt wurde und für die Leitung der Anlage verantwortlich war. Zugleich war Schnyder in seiner Funktion als Gemeinderat Mitglied des Vorstands. «Eine unsägliche Situation – als Mitglied des Vorstands kontrollierte ich mich damit selber». 1992 wurden strategische und operative Ebene entflochten, Schnyder trat aus dem Vorstand zurück und übernahm die Geschäftsführung im Mandatsverhältnis. Schon bald führte er im Abwasserverband eine Vollkostenrechnung und eine Anlagebuchhaltung ein. «Damit gab es für die an der Anlage beteiligten Gemeinden endlich eine Planungssicherheit.»
38,2 Mio. Franken in den Erhalt der Anlage investiert
Nach dem Amtsantritt von Schnyder wurde die 1972 eingeweihte, mit Kosten von rund 11 Millionen Franken erbaute Anlage zwischen 1991 und 2003 in drei Etappen vollständig saniert und mit der neusten Abwassertechnik ausgerüstet. Die Kosten für die Totalsanierung und -erweiterung beliefen sich auf mehr als das Doppelte der ursprünglichen Baukosten. Auch nach 2003 wurden stets die für den Werterhalt der Anlage notwendigen Investitionen getätigt. In der nunmehr 30-jährigen «Ära Schnyder» wurden insgesamt 38,2 Millionen Franken verbaut. «Die Anlage in Aarburg ist sowohl kostenmässig als auch technisch eine Vorzeigeanlage – das haben schweizweit durchgeführte Benchmarks unter Beweis gestellt», betont Schnyder nicht ohne Stolz.
Biologische Reinigung stösst an Kapazitätsgrenzen
Wieso aber muss in eine Vorzeigeanlage, die alle gesetzlichen Anforderungen bezüglich Qualität des gereinigten Abwassers erfüllt, nun so viel Geld investiert werden? «Kapazitätsmässig stösst die Anlage seit einigen Jahren an ihre Grenzen», sagt Erich Schnyder, die Zulauffrachten überschreiten die Dimensionierungswerte der Anlage. «Wir haben in unserem Versorgungsgebiet seit zehn bis 15 Jahren ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum», erläutert Schnyder weiter.
Insbesondere habe die biologische Reinigungsstufe ihre Kapazitäten erreicht. Reserven seien keine mehr vorhanden, wie 2017 eine Untersuchung des ausgewiesenen Experten Prof. Dr. Markus Boller gezeigt habe. Nur schon die vorübergehende Ausserbetriebsetzung eines Biologieteils bei einem Schadenereignis oder bei Revisionsarbeiten könne die Reinigungsleistung sehr stark beeinträchtigen.
Das Neubauprojekt, über welches die Abgeordneten am 15. September abstimmen werden, sieht die Anwendung eines neuen Reinigungsfahrens vor. Statt wie bis anhin in belüfteten Klärbecken wird die biologische Reinigung im sogenannten SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) neu in einem Reaktor vor sich gehen. Die drei geplanten Reaktoren sollen dabei in einem Neubau untergebracht werden.
Mit dem Neubau und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung würde die Anlage auch wieder über Reservekapazitäten verfügen. Statt wie bis anhin das Abwasser von 46 000 Einwohnergleichwerten – das bedeutet, dass Abwasser aus Industrie und Gewerbe auf Einwohner um- und mitgerechnet wird – wird die Anlage in Aarburg das Abwasser von 60 000 bis 70 000 Einwohnergleichwerten verarbeiten können. Trotz der hohen Investitionskosten werden die jährlichen Gemeindebeiträge dank den geäufneten Reserven nicht steigen.
Weitere Aufgaben werden sich stellen
Die nicht mehr benötigten Becken bleiben bestehen. «Es macht keinen Sinn, unnötige Kosten für einen Rückbau der Becken zu generieren», betont Erich Schnyder. Denn auch wenn das sein letztes Bauprojekt ist, das er begleiten wird: Er weiss, dass auf seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger bald schon weitere Aufgaben zukommen werden, die es (auch baulich) anzugehen gilt. «Die Elimination von Mikroverunreinigungen wird auch in Aarburg in absehbarer Zeit, spätestens aber 2035 erfolgen müssen», sagt Schnyder. Je nach Verfahren werde man die Becken dann wieder verwenden können.