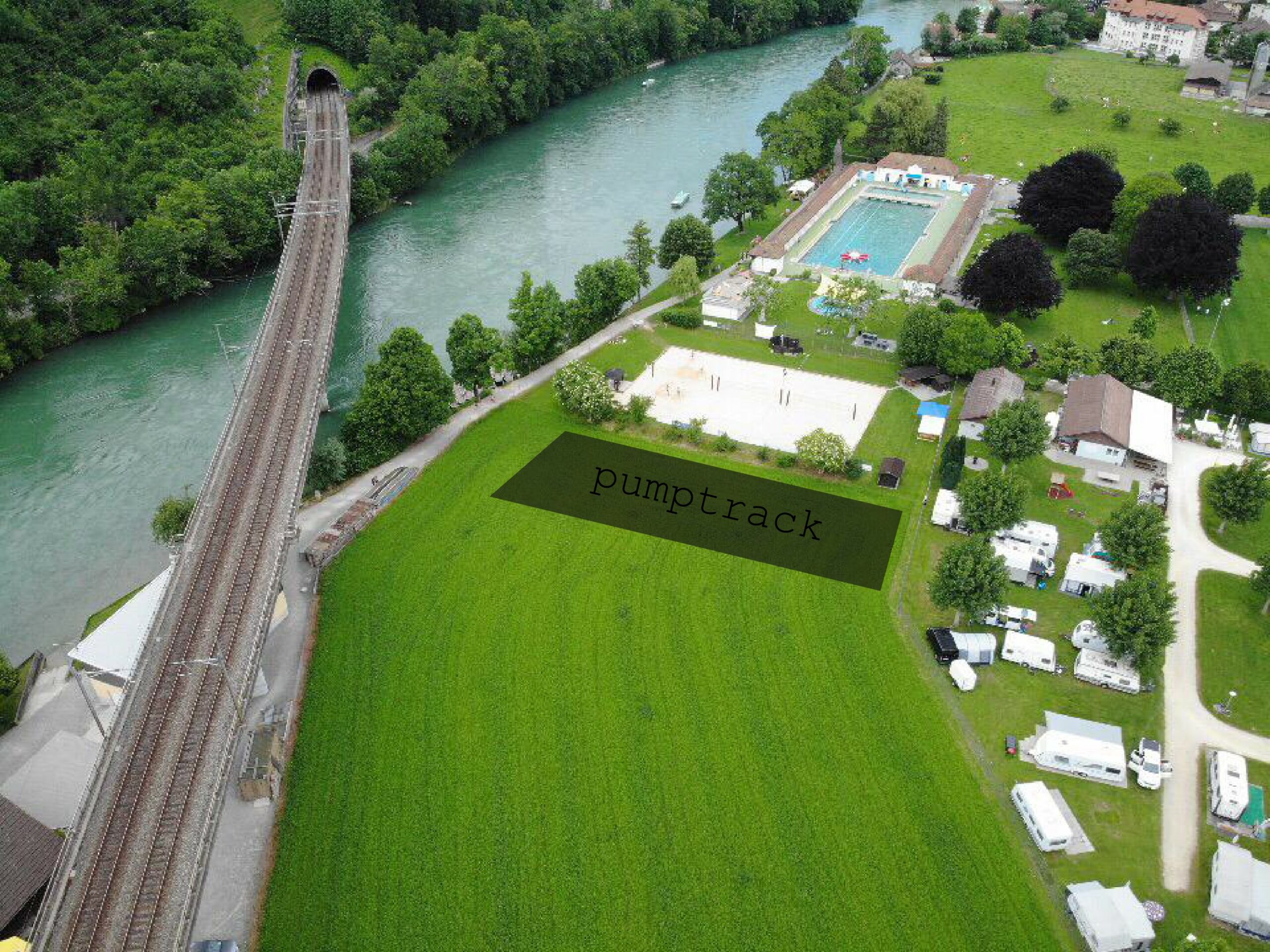«Der Wald wird sich in den kommenden Jahrzehnten radikal verändern»

Treffpunkt Forstwerkhof Aarburg. «Gehen wir doch gleich in den Wald», schlägt Jörg Villiger vor. Einzelne Sonnenstrahlen drücken durch die Baumkronen auf den Waldboden und tauchen den Wald in ein idyllisches Licht, frische Buchenblätter leuchten in hellem Grün. «Ja, für viele Leute ist der Wald grün und intakt», sagt Jörg Villiger. «Aber das ist ein Trugbild», betont der 57-jährige Leiter des Forstbetriebs Aarburg, der die Aarburger Wälder seit 1989 betreut, «die Veränderungen sind dramatisch».
Extreme Trockenheit setzt dem Wald zu
Villiger fährt betont langsam – um Staubwolken zu vermeiden. Rund einen Monat hat es schon nicht mehr geregnet, mindestens zehn weitere Tage soll es trocken bleiben. «Nach zwei wirklich trockenen Sommern ist es bereits jetzt wieder viel zu trocken», klagt der Förster. «Den Bäumen fehlt das Wasser.»
Die Zukunft wird der Schweiz trockenere und heissere Sommer sowie mildere Winter bescheren. Das sagen Klimamodelle voraus. Im heimischen Wald hinterlässt der Klimawandel aber bereits heute seine Spuren: Die Bäume sind anfälliger auf Krankheiten, wachsen langsamer oder sterben gleich ganz ab. Angeschlagen sind in erster Linie Fichten und Buchen, die beiden häufigsten Arten in den Schweizer Wäldern. Keine guten Aussichten für den Wald. «Ja, der Wald wird sich in den kommenden Jahrzehnten radikal verändern», bestätigt Villiger.
Fichten werden komplett verschwinden
Massiv gelitten haben in den vergangenen Jahren die Fichten oder Rottannen, wie sie im Volksmund auch genannt werden. Wegen ihrer flachen Wurzeln leiden die Fichten besonders unter trockenem Wetter und sie sind darum auch anfällig auf Sturmwinde. «Bei extremer Trockenheit können die Fichten nicht mehr genügend Harz produzieren und dann sind sie dem Borkenkäfer schutzlos ausgeliefert», weiss Jörg Villiger. «Die Fichte wird aus den Wäldern im Mittelland verschwinden», ist sich der Förster sicher.
Angeschlagen sind auch die Buchen. Ihnen macht eine Kombination aus Pilzen und Bakterien zu schaffen, die man an schwarzen Flecken auf der Rinde lokalisieren kann. «Den Buchen fehlt wegen der anhaltenden Trockenheit die Kraft, um sich gegen den Pilzbefall zu wehren», mutmasst Jörg Villiger. Auch die Buche werde in Zukunft einen schweren Stand haben, ist sich Villiger sicher. Verschwinden werde sie aus den hiesigen Wäldern nicht, aber ihre Bestände würden massiv zurückgehen.
Der Hoffnungsträger Esche ist ebenfalls krank
Was pflanzen, wenn die beiden häufigsten Bäume in den Schweizer Wäldern schwächeln? Die Forstwirtschaft hat auch auf die Esche gesetzt. Sie sollte ihren Beitrag zum klimatauglichen Umbau des Waldes leisten. Auch in Aarburg. Weil die Esche ein Baum ist, der je nach Art sowohl an trockenen als auch an feuchten Standorten angepflanzt werden kann. Zudem ein Edelholz mit vorteilhaften Eigenschaften – schwer und hart, aber trotzdem elastisch. «Rund 90 Prozent der Eschen im Wald der Ortsbürgergemeinde sind krank», gibt Jörg Villiger zu verstehen. Das Eschentriebsterben hat sich in den letzten Jahren rasant ausgebreitet. Die Pilzkrankheit bedroht in der Zwischenzeit die gesamten Eschenbestände in Europa. Ein Waldsterben also? Jörg Villiger wehrt ab. Er möchte nicht von einem Waldsterben sprechen, sondern von einem Baumartensterben. «Man darf sich nicht verrückt machen lassen, auch wenn man viele schöne, grosse Bäume eingehen sieht», fordert er. «Die Natur wird uns zeigen, was wo gepflanzt werden kann», sagt der erfahrene Förster.
Zwischenhalt bei einer Kahlschlagfläche im Säliwald. «Hier haben wir alle absterbenden Eschen gefällt», erklärt Jörg Villiger, «und die ganze Fläche neu bestückt – vorwiegend mit Walnuss- und Kastanienbäumen». Diese beiden Baumarten wachsen im Süden, dort wo es bisher schon heiss und trocken ist, meint Villiger weiter. «Das könnte auch unsere Zukunft sein, aber das werden wir erst Jahrzehnte später wissen.»
Mischwald soll erhalten bleiben
Auf jeden Fall wäre es falsch und gefährlich, bei Neubepflanzungen nur auf eine Baumart zu setzen. «Der Mischwald soll hier erhalten bleiben», betont Villiger. Deshalb werden auf der abgeholzten Fläche neben Walnuss und Kastanie auch Eiben, Elsbeeren und Speierling angepflanzt. «Ein vielfältiger Wald ist weniger anfällig – gegen Trockenheit, Schädlinge, Krankheiten», sagt Villiger mit Nachdruck. Es brauche die Eingriffe des Menschen, damit sich der Wald dem sich wandelnden Klima anpassen könne. «Naturverjüngung, das funktioniert nur bedingt», sagt Villiger. Würde man den Wald sich selbst überlassen, würden hauptsächlich Fichten und Buchen nachwachsen. Genau das, was man nicht wolle, weil es keine Zukunft hat.
Der Wald hat verschiedene Funktionen
Eingriffe seien auch notwendig, damit der Wald seine verschiedenen Funktionen erfüllen könne. Der Wald sei nicht nur Rohstofflieferant, sondern auch Erholungsort und Biotop. «Wo sich Menschen bewegen und Erholung suchen, muss der Förster auch Sicherheitsaspekte beachten und kranke Bäume entfernen.» Andererseits werde in Naturwaldreservate gar nicht eingegriffen. So etwa im Murgenthaler Fätzholz, wo die Ortsbürgergemeinde Aarburg Ende 2016 eine Reservatsfläche von rund 53 Hektaren ausgeschieden hat. Auf Holznutzung und Pflegeeingriffe wird dort während mindestens 50 Jahren komplett verzichtet. Das Holz bleibt liegen, verfault, wird von Käfern, Pilzen und Würmern zersetzt. Nirgendwo im Wald ist die Artenvielfalt höher als auf Totholz. «Der Wald ist ein komplexes System mit vielen Funktionen, das man nicht nur aus ökonomischer Sicht betrachten darf», resümiert Villiger.