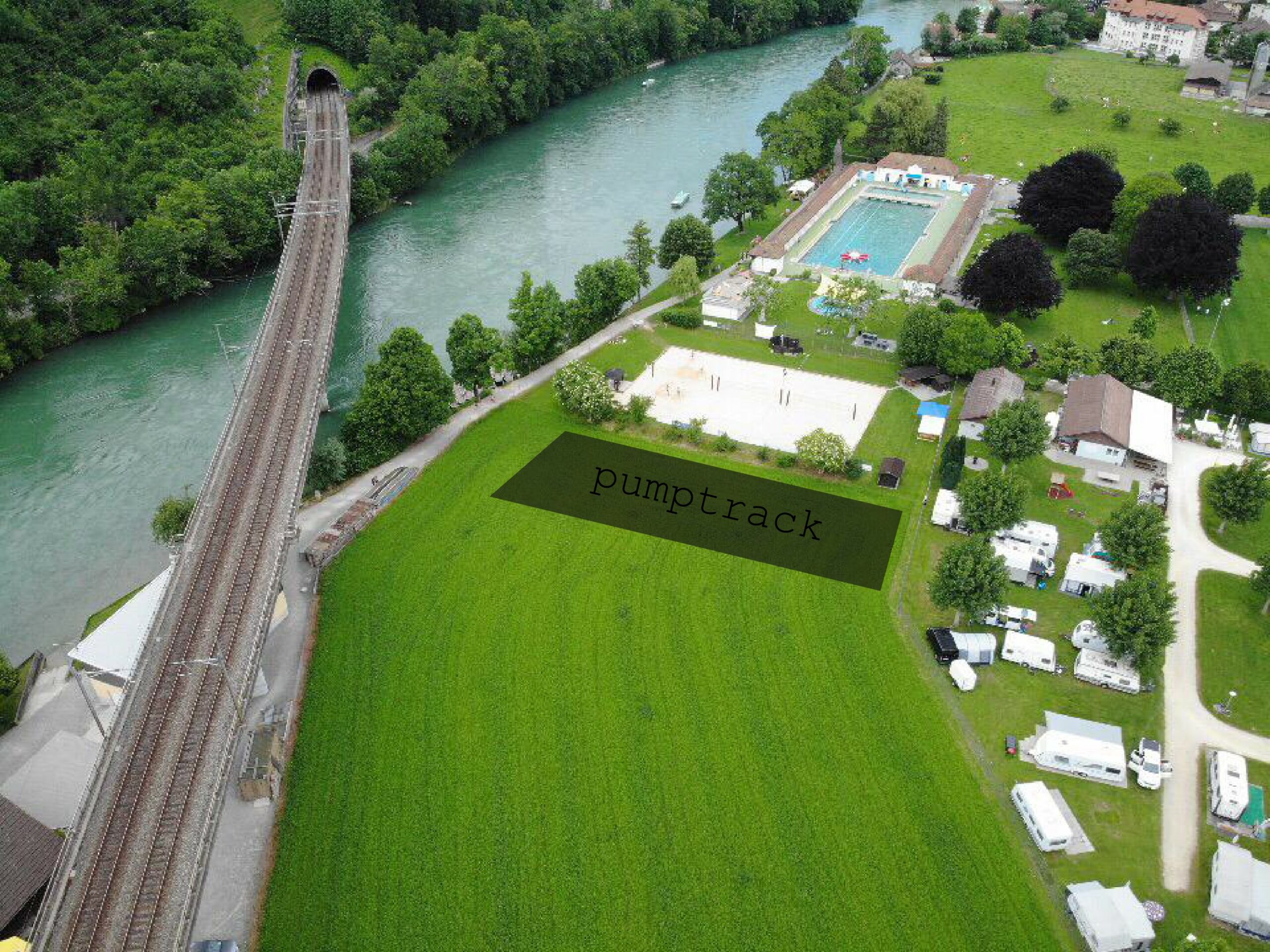Der Wald stirbt nicht, er befindet sich im Wandel
Gleich zu Beginn stellte der Aarburger Revierförster Jörg Villiger fest, es sei eigentlich falsch, von einem Waldsterben zu sprechen, da der Wald die Fähigkeit habe, sich stets zu erneuern. Trotzdem sei der Wald wegen des Klimas – Stichwort Trockenheit – in einem schlechten Zustand und für viele einheimischen Bäume gäbe es keine Zukunft, sagte Villiger. Mit rund 110 Hektaren ist der Säliwald das grösste zusammenhängende Stück der total 260 Hektaren der Aarburger Waldungen.
Gleich hinter dem Friedhof wurde beim Waldgang zum ersten Mal Halt gemacht; bei einem Bijou im Säliwald, dem Tiefelach-Weiher. Leider verlocke die schöne Anlage immer wieder Kinder dazu, Bollensteine ins Wasser zu werfen und so die Ufer zu zerstören. Auch werden Fische ausgesetzt, welche das ökologische Gleichgewicht im Weiher stören. Auf dem Weg zum Spiegelberg erklärte Villiger, welche Bäume in einem Waldstück, das dem Sturm Burglind zum Opfer fiel, neu eingepflanzt werden. Es sind dies vor allem Eibe, Elsbeere, Nussbaum, Edelkastanie sowie die Exoten Mammut- und Riesenlebensbaum. Douglasie und Lärche, an anderen Standorten Hoffnungsträger, haben wegen der Trockenheit im Säliwald keine Chance.
Ein weiterer Stopp wurde zwei Laubbaumarten gewidmet, denen es nicht gut geht. Die Esche wird seit Beginn der 1990er-Jahre durch ein zuerst in Polen aufgetretenes und inzwischen in weiten Teilen Europas verbreitetes Eschensterben bedroht, das vom Schlauchpilz Hymenoscyphus fraxineus verursacht wird. Aber auch die Buche, der häufigste Laubbaum im Aargau, leidet stark, verfärbt sich gelb. Astweise sterben die Kronen ab. Schuld ist die Buchennekrose mit Schleimfluss. Gemäss der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ist eine der Ursachen für die Buchennekrose ebenfalls die Trockenheit.
An Hand von Grafiken und Bildern zeigte Kreisförster Erwin Städler die Entwicklung des Klimas seit Messbeginn 1864 bis in die Zukunft auf. Die Berechnungen des WSL verheissen nicht viel Gutes. Wenn der CO2-Ausstoss nicht drastisch reduziert wird, gibt es in 30 Jahren im Mittelland keine Buchen und Fichten mehr.
Auch der Borkenkäfer war ein Thema. Ihm fallen vor allem die Fichten zum Opfer. Immer wieder werde gefordert, man müsse beginnen, Bäume aus dem Mittelmeerraum zu pflanzen. Die beiden Förster stehen diesen Plänen skeptisch gegenüber. Zum einen wisse man nicht, wie sie auf die hier heimischen Pilze und Käfer reagieren, zum anderen hätten sie sicher mit den auch in Zukunft noch auftretenden Spätfrosten zu kämpfen.
Ein Posten war der Jagd gewidmet. Jagdaufseher Peter Baumgartner stellte die Jagdgesellschaft Aarburg-Oftringen-Rothrist vor, welche das Gebiet des Säliwaldes gepachtet hat. Einen grossen Teil seines Referates widmete Baumgartner den wohl intelligentesten Bewohnern des Waldes, dem Schwarzwild und dem Katz-und-Maus-Spiel mit dieser Plage für die Landwirte. Übrigens kann das Fleisch der erlegten Tiere (natürlich auch Rotwild) bei der Jagdgesellschaft käuflich erworben werden.
Zum Abschluss des Waldganges offerierte die Einwohnergemeinde bei der Waldhütte Hühnerweid ein Zvieri. Bei Speis und Trank wurde bis tief in die Nacht über die Zukunft des Waldes diskutiert. (hha)