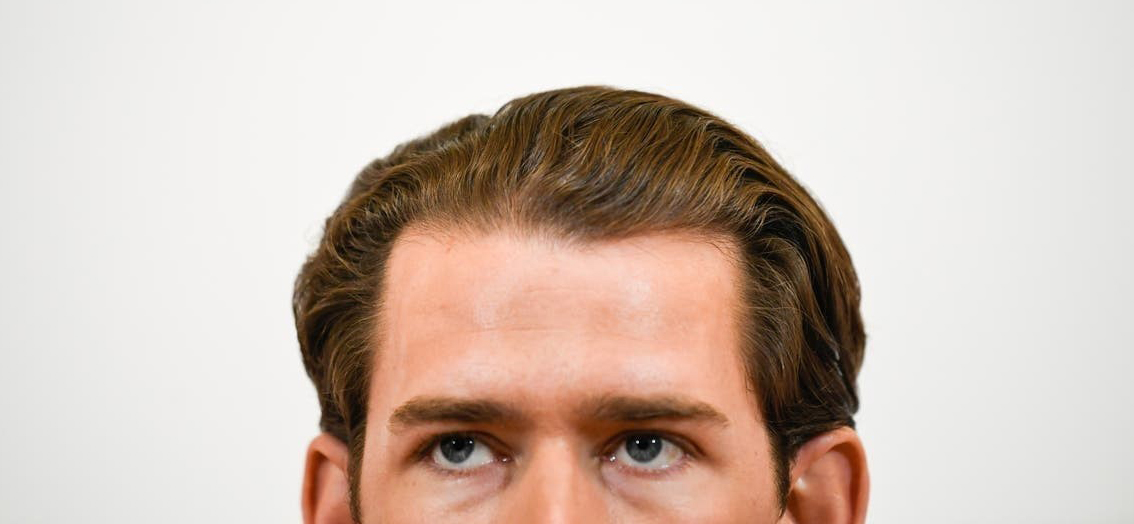Eine bittere Kollision mit der Realität: Ist die grüne Welle abgeebbt?
Bedeutungsschwer blickten die Chefs der Grünen in die Kamera. Die Lage sei ernst, sagte Fraktionspräsidentin Aline Trede. Und für Parteipräsident Balthasar Glättli stand fest: «Wir müssen diese drei Vorlagen unbedingt gewinnen.» In Werbeclips erklärten sie die Abstimmungen über das CO2-Gesetz und die beiden Agrar-Initiativen zu einer Art Schicksalsfrage für Land und Leute, eindringlich sprachen die beiden von «den grössten Herausforderungen, die wir im Moment haben».
Mit dem Slogan «Dreimal Ja für Klima und Biodiversität» wollten die Grünen ihre Erfolgswelle aus den nationalen und kantonalen Wahlen fortsetzen. Ihre Botschaft: Alles kann gelingen. Das CO2-Gesetz, für viele nur noch eine Formsache. Ein selbstverständlicher Kompromiss. Schon war die Rede davon, ein schnelles Verbot für Benzinautos und neue Ölheizungen durchzusetzen. Zumindest atmosphärisch, so schien es, bestimmten ökologische Fragen die Prioritätenliste vieler im Land.
Statt dreimal Ja gab es am Ende dreimal Nein. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: eine Kluft. Es ist eine grüne Kollision mit der Realität, sichtbar vor allem bei der Ablehnung des CO2-Gesetzes. Umfragen zufolge wollen die meisten im Land, dass der Klimawandel bekämpft wird. Auch die Energiestrategie kam an der Urne durch. Aber mehr Geld für den Klimaschutz will eine Mehrheit nun doch nicht zahlen. Wenn es ans Portemonnaie geht, sieht die Sache ein wenig anders aus.
Das CO2-Gesetz als «Gesetz der anderen»
Ist dieser 13. Juni ein Einschnitt für die Grünen? Dass Gegner die grüne Welle wahlweise für abgeebbt, vorüber oder beendet erklären – geschenkt an diesem Sonntag. Bei der Partei selbst schöpfte man derweil zuerst aus der Erzählung, dass die terminliche Verknüpfung mit den beiden Agrar-Initiativen zum Nein geführt habe. Das Resultat stand noch nicht definitiv fest, da sprach Parteichef Glättli in Interviews schon davon, wie angesichts dieser Kumulierung gerade in ländlichen Regionen nicht mehr differenziert abgestimmt worden sei.
Später am Tag griff Glättli insbesondere die FDP scharf an. Deren Parteileitung hätte es nicht geschafft, sich gegen die Erdöllobby in den eigenen Reihen durchzusetzen. Die Freisinnigen seien «wieder Teil des Problems statt der Lösung». Reihum und offensiv stellten Grünen-Politiker die Vorlage nun als marktwirtschaftlich geprägten Kompromiss dar, der aus ihrer Sicht ja eigentlich sowieso zu wenig weit gegangen wäre. Frei nach dem Motto: das CO2-Gesetz als «Gesetz der anderen».
Einen Kippmoment wollten die Grünen indes nicht festmachen. Der Zürcher Nationalrat Bastien Girod schrieb in einem Tweet zwar vom «schwersten Rückschlag für den Klimaschutz» in seiner politischen Karriere. «Es ist aber kein grundsätzliches Nein zu mehr Klimaschutz, sondern ein Auftrag für einen (noch) mehrheitsfähigeren Klimaschutz.»
Terraingewinne trotz Abstimmungsniederlage
Kein Ende der grünen Welle also? Im Gegenteil, fand Parteivizechefin Franziska Ryser: «Das Resultat zeigt, dass eine starke Vertretung der Grünen im Parlament mehr denn je notwendig ist.» So müsse man jetzt noch mehr kämpfen, um die Kompromisse in der Klimapolitik im eigenen Sinne prägen zu können.
Gleichzeitig sollten die Grünen aus Sicht der St.Galler Nationalrätin diese Ausgangslage auch nutzen, «um noch klarer aufzuzeigen, dass wir die Partei mit den effektiven Lösungen im Klimaschutz sind». Ryser hält es gar für möglich, dass die Ablehnung des CO2-Gesetzes den Grünen bei künftigen Wahlen weitere Terraingewinne bei enttäuschten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern beschert.
Im Parlament freilich präsentiert sich die grüne Welt ohnehin bescheidener: Auch nach dem Wahlerfolg der Partei haben sich die Kräfteverhältnisse nur bedingt verändert; trotz bemerkenswerter Akzentverschiebungen gerade in gesellschaftspolitischen Fragen. Und von betont gemässigten Vorstössen zwecks Demonstration der eigenen Kompromiss- und Regierungsfähigkeit einmal abgesehen, politisiert die homogene Grünen-Fraktion prononciert links. Selbst als 13,2-Prozent-Partei lassen sich Wahlerfolge nicht so leicht in Parlamentserfolge ummünzen.