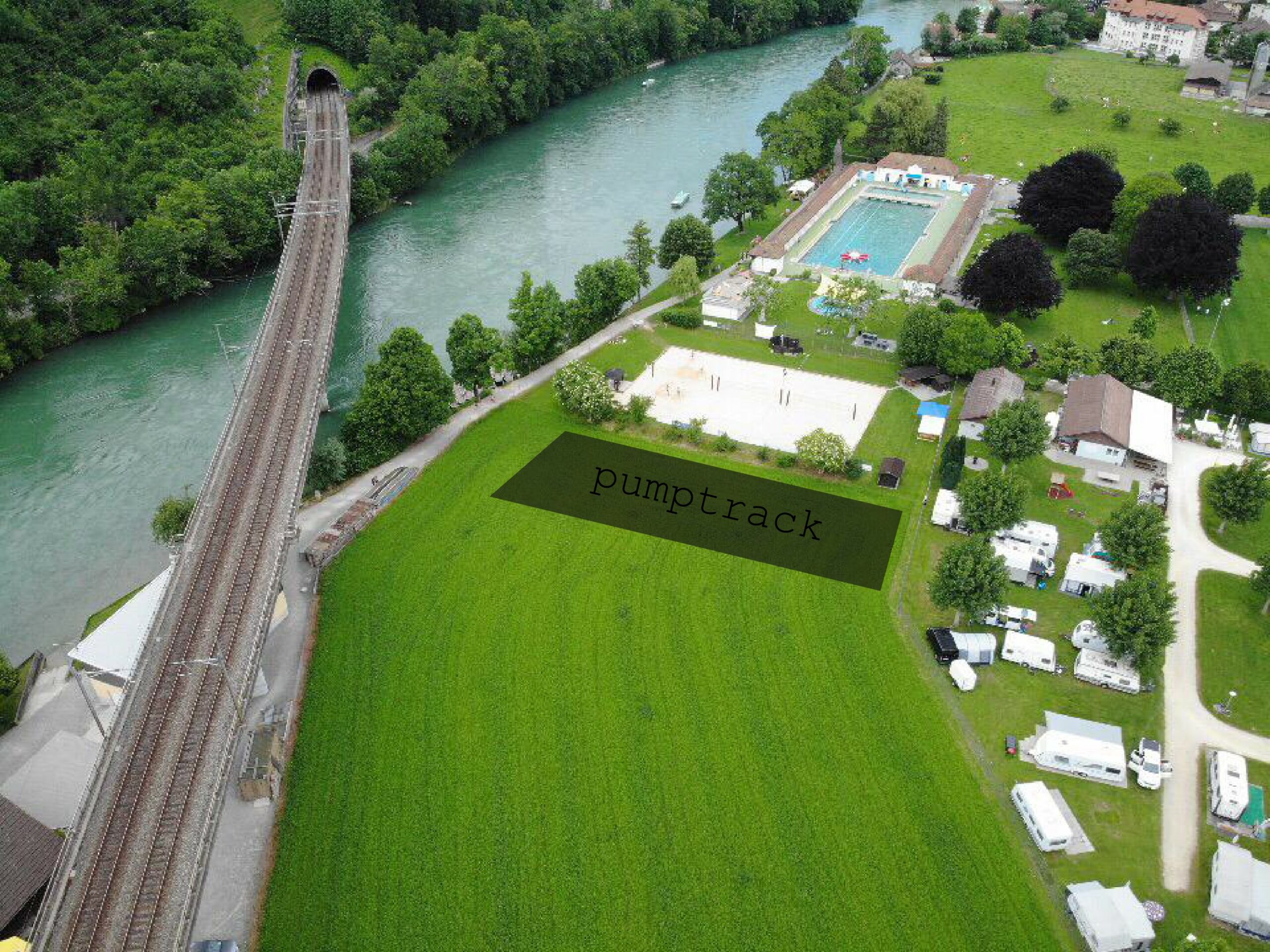Als das Städtli im Verkehr erstickte und wieder zu Atmen begann – GALERIE

2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn) 
2018 Nordportal: Die ersten Meter des Festungstunnels im Norden wurden im Tagbau errichtet. Mehrere Häuser mussten weichen. Auf dem Feld beim Alten Friedhof wurde ein Humusdepot errichtet – ein Berg, der in den ersten Wochen der Baustelle in die Höhe wuchs. Zu sehen ist heute einzig noch das Portal der Ortskernumfahrung. (pmn)
Über eine Verkehrsentlastung von Aarburg wurde seit Jahrzehnten debattiert. Folgend die wichtigsten Schritte.
1978–1979 Variantendiskussion im Rahmen des kantonalen Richtplanes
31. Oktober 1982 Nein der Aarburger zum generellen Projekt Festungsdurchsicht und damit erstes Nein zu einer Entlastung
1987 Einsetzung der Kommission Ortskernumfahrung durch den Gemeinderat
1989–1990 Machbarkeitsstudie Verkehrsentlastung Aarburg im Auftrag des Kantons
24. September 1990 Aargauer Regierung genehmigt Kredit für generelles Projekt
3. Juni 1993 Die Aarburger sagen überdeutlich (387 zu 17 Stimmen) Ja zum generellen Projekt
17. Mai 1994 Der Grosse Rat heisst die Vorlage gut
1999 Provisorische Genehmigung durch die Regierung
2002 Definitive Genehmigung
15. Juni 2004 Beitragszusage des Bundes
26. Oktober 2004 Spatenstich in Aarburg
26. Oktober 2007 Eröffnungsfeier
Als am 13. September 2004 die Bauarbeiten zur 127 Millionen Franken teuren Ortskernumfahrung (Okua) beginnen, steht Claude König aus Holziken an vorderster Front. Der Mitarbeiter des Ingenieurbüros Rothpletz Lienhard ist einer von zwei vom Kanton beauftragten Chefbauleitern. «Es war bis dato meine interessanteste und vielfältigste Baustelle», erinnert sich König. «Sie innert dreier Jahren fertigzustellen, war nicht nur ein Erfolg – es war eine Erleichterung.» Der Paradieslitunnel, für den der damals 33-Jährige zuständig war, wurde im Tagbau erstellt – der Boden musste aufgebrochen, ein riesiges Loch ausgehoben und wieder zugedeckt werden. «Das Bornfeld haben wir für die Landwirtschaft wieder vollständig hergestellt.» Heute ist das Gelände überbaut.
Über eine Zentrumsentlastung war zum Zeitpunkt des Starts schon seit Jahrzehnten diskutiert worden. Der massive Verkehr im Städtli sorgte für einen «Verkehrsinfarkt». Grünes Licht kam erst im Juni 2004 mit der Zusicherung des Bundesbeitrags über knapp 50 Millionen Franken. Der Verkehrsminister, Bundesrat Moritz Leuenberger, überreichte den Brief damals dem strahlenden Regierungsrat Peter C. Beyeler gar höchstpersönlich (siehe Info-Box rechts).
Riesengrube statt Rosenstock
Anspruchsvoll war die Aufgabe laut Chefbauleiter König auch aufgrund der engen Platzverhältnisse. Einige Gebäude wurden abgerissen. Andere Anwohner hatten im Garten statt Blumen nur noch eine Baugrube. «An der Bornstrasse arbeiteten wir uns quasi von Hausfassade zu Hausfassade», sagt König. Was lustig klingt, war ernst. Die Anwohner schauten den Bauarbeitern genauestens auf die Finger. Tagsüber hatten sie den Lärm, abends den Staub im Haus. «Dennoch», sagt Claude König, «gab es vor allem positive Erlebnisse.» Wie ein älterer Herr, der die «Büezer» in seine Stube zu Znüni und Schwatz einlud. Schliesslich habe man sich alle Mühe gegeben, die Anrainer zu befriedigen. Sämtliche Hauszuleitungen wurden mit Provisorien sichergestellt. Den Tychbach leiteten die Bauleute durch ein Rohr über die Grube. Die Quartierstrassen wurden mithilfe von Hilfsbrücken über die Baugrube geleitet. Für den Zugang zu einer Liegenschaft wurde eigens eine provisorische Fussgängerbrücke erstellt. «Und wenn jemand den Weg zur extra erstellten Autogarage nicht mehr gehen konnte», so König weiter, «dann liessen wir Bagger und Walze auffahren, und in Kürze hatte er einen provisorischen Parkplatz.»
Auch der damalige Sicherheits- und heutige Bauvorsteher Rolf Walser erlebte das Geratter hautnah. Sein Wohnhaus steht nur 100 Meter vom Bauplatz entfernt. «Wir spürten die Erschütterung jeden Tag», sagt der Gemeinderat. «Die Anwohner hatten natürlich Bedenken.» Weggezogen sei trotzdem (fast) niemand. Die Kosten: Der Anteil der Gemeinde an die Umfahrung mit Festungs- und Paradieslitunnel betrug 9,23 Millionen. Eröffnet wurde die Okua am 26. Oktober 2007, mit diversen Attraktionen wie einem Cremeschnitten-Rekord. «Absolut cool» sei das gewesen, blickt Gemeinderat Walser zurück. Den Behörden fiel ein Stein vom Herzen; denn der Bau absorbierte die Ressourcen stark. «Für andere Projekte blieb weder viel Zeit noch Geld.»
Ein Ende, und doch ein Anfang
Letztlich war die Eröffnung auch wieder ein Startschuss – zur Stadtaufwertung nämlich. Eine Dynamik wurde angestossen, lukrative Bauprojekte lanciert, Investoren vermehrt auf die 8000-Seelen-Stadt (2007 waren es noch 6500) aufmerksam. «Die ganzen positiven Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich Bahnhof oder Oltnerstrasse, hätte es nie gegeben», ist Walser sicher.
Als Konsequenz der Ortskernumfahrung wird als Nächstes die Oltnerstrasse zur Zentrumsachse mit Platz für Langsamverkehr und öV ausgebaut. Kostenschätzung: 21 Millionen Franken. «Die Verkehrsproblematik im Norden Aarburgs ist noch ungelöst», sagt Walser. Durch die Umfahrung hat der Verkehr zwischen Olten und dem Autobahnanschluss Rothrist stark zugenommen. Die Quartierbewohner sollen endlich wieder besser auf die Kantonsstrasse gelangen können. Rund 28 000 Fahrzeuge täglich sind auf dieser Hauptachse unterwegs. Doch diese ganzen Autos und Lastwagen drängen sich heute wenigstens nicht mehr direkt durchs Städtli. Der «Verkehrsinfarkt» im Zentrum – er ist dank Okua-Bypass geheilt.
Bilder: Amt für Tiefbau (ATB), Patrick Furrer (fup), Philipp Muntwiler (pmn)