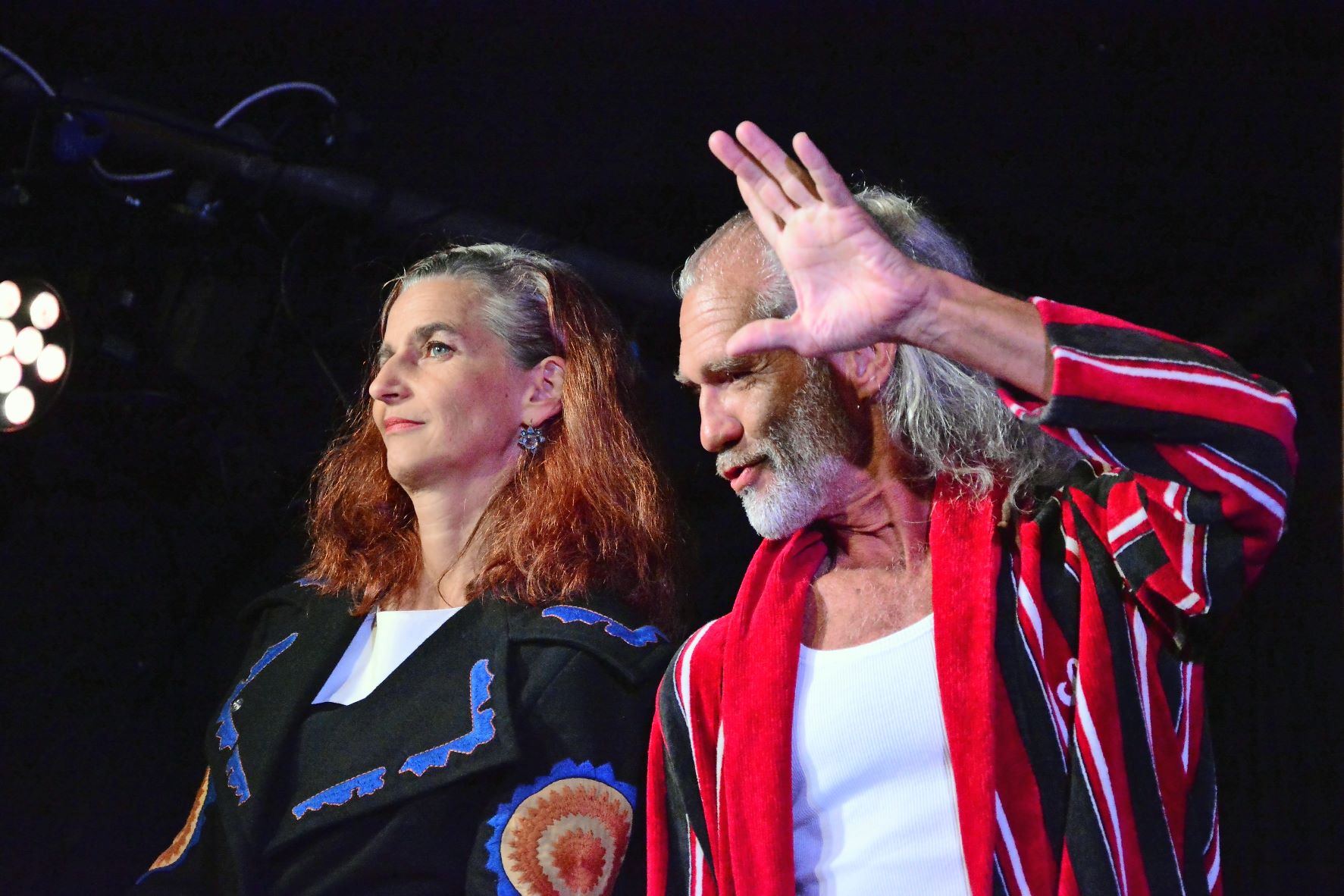Brieftaubenfotografie: Der unbekannte Pionier aus dem Ruedertal

Selten hat wohl jemand den Begriff «Vogelperspektive» wörtlicher genommen als die beiden Pioniere Julius Neubronner und Adrian Michel.
Die wahre Vogelperspektive
Erfunden hat die Brieftaubenfotografie 1903 der deutsche Hofapotheker Julius Neubronner. Er setzte Brieftauben ein, um Rezepte und Medikamente bis zu einem Gewicht von 75 Gramm rasch verschicken zu können. Dann konstruierte er eine leichte Miniaturkamera, die mithilfe eines Geschirrs auf die Brust der Tauben geschnallt wurde. Was anfänglich eher als Jux gedacht war, funktionierte recht gut. Die Tauben brachten Luftaufnahmen von ihren Flügen zurück.
Neubronner pröbelte weiter, erhielt 1907 das Patent für seine Erfindung, die er an der internationalen Luftschifffahrtausstellung in Frankfurt präsentierte. Da meldete das preussische Kriegsministerium sein Interesse an. Doch die Luftaufklärung durch die Brieftaubenfotografie funktionierte nicht so, wie sich das die Preussen vorgestellt hatten. Erstens wusste man nie genau, was für Aufnahmen die Tauben zurückbringen würden. Zudem dauerte es viel zu lange, bis die Brieftauben nach der Versetzung des Taubenschlages umgelernt hatten.
Trotz des Misserfolgs in militärischen Belangen ist die Brieftaubenfotografie nie ganz ausgemustert worden. Vor dem 2. Weltkrieg trainierte das deutsche Militär mit fotografierenden Brieftauben, die Franzosen rühmten sich, sie könnten die jetzt filmenden Tauben mittels trainierter Hunde hinter die feindlichen Linien bringen und dort starten lassen. Und auch in den USA soll man mit dem Einsatz von Brieftauben für die militärische Aufklärung experimentiert haben.
Als Adrian Michel aus Schmiedrued-Walde 1931 zum militärischen Hilfsdienst bei den Brieftauben einrückte, wusste er nichts von alledem. Er stiess dann aber auf Neubronners Kamera und erkannte das Verbesserungspotenzial und erfand eine neue Kamera. Er optimierte die Mechanik und reduzierte das Gewicht. Wahrscheinlich baute der aus einer Uhrenmacherdynastie stammende Michel die erste Kamera mit Federwerk. Die Schweizer Armee war anfänglich an Michels neuer Kamera, die 1937 patentiert wurde, stark interessiert. Michel erhoffte sich, die Kamera in seiner Fabrik in Schiltwald in grosser Stückzahl produzieren zu können. Doch das Militär zog sich zurück. Der Auftrag blieb aus. Desillusioniert wandte Michel sich anderen Projekten zu.
Das Schweizer Kameramuseum besitzt rund 1000 Aufnahmen, die Michel während der Entwicklung seiner Kamera für Testzwecke gemacht hat. 2007 widmete das Museum in Vevey Adrian Christian Michel aus Schmiedrued-Walde die Ausstellung «Des pigeons photographes?». Im Aargau wurde sie kaum beachtet.
Christian Adrian Michel (1912–1980) war ein genialer Tüftler. Er lebte im Ruedertal, hatte eine kleine Fabrik in Schiltwald und war in jenem Schulhaus zur Schule gegangen, das später dem ebenso genialen Schriftsteller Hermann Burger als Schauplatz für seinen Roman «Schilten» diente. Im Gegensatz zu den Figuren in Burgers Roman war Adrian Christian Michel jedoch real existierend. Und seine Erfindung, die ihn beinahe reich und berühmt gemacht hätte, war es auch. Aber sie hätte dennoch gut in das Burgersche Erzähluniversum gepasst: Michel erfand die weltweit einzigartige «Brieftauben-Panorama-Kamera».
Die 1937 patentierte Kamera war nur gerade 70 Gramm schwer. Sie wurde speziell ausgebildeten Brieftauben mit einem ebenfalls von Michel entwickelten aerodynamischen Traggestell vor die Brust gehängt. «Es können hierfür jedoch nur trainierte Tauben verwendet werden», warnte Michel in der Bedienungsanleitung zu seiner Kamera. Gut geschulte Brieftauben brachten denn auch Luftaufnahmen von aussergewöhnlicher Bildschärfe von ihren Flügen zurück.
Eine Uhrenfabrik im Ruedertal
Um 1900 war das Ruedertal ein armes Tal. Ausserhalb der Landwirtschaft gab es kaum Arbeitsplätze. In Schmiedrued wurde Gemeindeammann Albert Hunziker aktiv. Eine Uhrenfabrik würde dem Dorf guttun, erkannte er und fragte die Firma Adolf Michel SA in Grenchen an, ob sie im Weiler Schiltwald eine Filiale eröffnen möchte. Die Firma war einverstanden, stellte aber Bedingungen: Kostenloses Bauland, Strom und Wasseranschluss sowie ein Fabrikgebäude. Die Schmid-rueder gingen den Handel ein. Bereits ab 1914 wurden in der von den Dorfbewohnern finanzierten und gebauten neuen Fabrik Uhrwerke hergestellt. Betriebsleiter war Adrian Othmar Michel, der mit seiner Familie von Grenchen nach Schiltwald gezogen war. 1921 erwarb er von seinem Onkel Adolf Michel die Schiltwalder Filiale der Uhrenfabrik, die mehr schlecht als recht lief. Die Fabrik hiess jetzt «Adrian Michel, Ebauches et Finissage». Weil Not am Mann war, trat Adrian Christian Michel mit 19 Jahren in den väterlichen Betrieb ein. Er hatte die Bezirksschule besucht und die Handelsschule in Neuenburg, aber er hatte keinerlei technische Ausbildung. Dennoch fiel er sofort mit seinen unkonventionellen Ideen auf; er erkannte, dass die Fabrik seines Vaters diversifizieren musste, wenn sie überleben wollte. So stellte man in Schiltwald schon bald neben den Uhrwerken auch Veterinärartikel her.
Die Erfindung der Kamera
1932 musste der junge Michel in die Rekrutenschule einrücken. Er mochte das Militär nicht und schaffte es, im Brieftaubendienst eingeteilt zu werden. Er war fasziniert und eignete sich alles an, was er über Brieftauben lernen konnte. Dabei stiess er auf die Erfindung, die der deutsche Apotheker Julius Neubronner 1907 zum Patent angemeldet hatte: eine zeitgesteuerte Miniaturkamera für Brieftauben. Obschon Neubronners Brieftaubenkamera bereits erste Luftaufnahmen lieferte und Apotheker Neubronner eine Reihe von Auszeichnungen bescherte, setzte sich die Kamera nicht durch. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor das deutsche Militär das Interesse an Luftaufnahmen; die Erfindung war in Vergessenheit geraten. Bis sie der militärischen Hilfsdienst leistende Adrian Christian Michel 1931 wiederentdeckte.
Michel baute eine neue, bessere und leichtere Kamera für Brieftauben, mit einer Mechanik, welche die Verzögerungen beim ersten Bild sowie zwischen den Aufnahmen kontrollierte und den Film transportierte. Seine «Brieftauben-Panorama-Kamera» wurde 1937 patentiert. Es handelte sich um eine der ersten Kameras mit Federwerk. Michel erkannte das Potenzial, das in der Kamera steckte; er pröbelte weiter, schickte die Tauben aus zum Fotografieren des Mittellandes. Die belichteten 16-Millimeter-Filme lieferten oftmals Fotos von erstaunlicher Schärfe. Das Schweizer Kameramuseum in Vevey besitzt rund 1000 Aufnahmen, die Michel während der Entwicklung seiner Kamera für Testzwecke gemacht hat.
Die Armee will doch nicht
Grosse Hoffnungen setzte Michel ins Schweizer Militär. Er hoffte, dass die Schweizer Armee, auch angesichts der Kriegsgefahr, auf seine PanoramaKamera für Aufklärungsflüge setzen würde. Und später vielleicht auch andere Armeen aus anderen Ländern. Vielleicht hat er auch davon geträumt, dass auch Privatpersonen in ihrer Freizeit zum Vergnügen die mit seiner Kamera ausgerüsteten Brieftauben zum Fotografieren losschicken. So, wie es viele Heutige mit ihren Drohnen tun.
Michel war bereit. Er hatte das Patent, hatte die Kamera zur Serienreife gebracht und eine detaillierte und aufwendig gemachte Betriebsanleitung geschrieben. Doch das Schweizer Militär zeigte kein Interesse für Luftaufklärung mit der Brieftaubenkamera. Die Brieftauben waren zu wenig zuverlässig, weil sie auf Umwelteinflüsse reagierten. Ihre Flugrouten waren nicht präzis planbar. Sie brachten zwar gute Fotos mit, aber oft von den falschen Orten. Die Schweizer Armee setzte ohnehin schon bald nicht mehr auf Brieftauben. So kam es, dass von Michels einzigartiger Kamera nur gerade 100 Exemplare gefertigt wurden.
Einige wenige Kameras sind erhalten geblieben. Sie gelten als gesuchte Raritäten. Gelegentlich tauchen sie an Auktionen auf. Zwischen 2002 und 2007 versteigerte Christie’s in London drei original Michel Brieftauben-Panorama-Kameras, ausgerüstet mit Objektiven der Aarauer Firma Kern. Die Kameras erzielten Preise von jeweils über 10’000 Pfund.
Adrian Christian Michel beschäftigte sich weiter mit Brieftauben. Er richtete in Schiltwald einen Taubenstand ein; später erhielt er das Patent für die von ihm erfundene Brustdepeschenhülse für Tauben zum Transport kleiner Gegenstände wie Filmrollen. Er entwickelte zudem einen geflochtenen Behälter zum Transportieren einzelner Brieftauben auf Hunden. Daneben betrieb der rastlose Michel die erste Tankstelle im Tal und fuhr erfolgreich Motorradrennen, wie die erhaltene Pokalsammlung eindrücklich bezeugt.
Raclette-Öfeli aus Schiltwald
Nachdem es mit der Produktion von Brieftauben-Kameras in Schiltwald nicht geklappt hatte, zog die Firma einen ganz anderen Auftrag an Land: Die Herstellung von Kochherdschaltern prägte bis in die Sechzigerjahre die Tätigkeit der Firma und brachte willkommene Heimarbeit ins Ruedertal. Zu den Produkten aus Schiltwald zählten im Laufe der Zeit auch Rücklichter für Velos, Hundemarken oder Velo- und Mofaschilder. Als in den Siebzigerjahren die ganze Schweiz zu Hause Raclette essen wollte, war Adrian Christian Michel sofort zur Stelle. In den besten Jahren produzierte sein Betrieb jährlich für die Migros bis zu 40 000 Raclette-Öfeli.
Nach dem plötzlichen Tod des Patrons im Jahre 1980 übernahm Ehefrau Erna Michel zusammen mit Sohn Adrian die Betriebsführung; dessen Bruder Markus Michel kam 1994 in den Betrieb. Sie spezialisierten sich auf Stanz- und Biegeteile für Kunden in der Schweiz, in Europa und Asien. Die Firma wuchs, zählte rund 60 Angestellte und wurde baulich mehrmals erweitert. Das ursprüngliche Gebäude, wo 1914 alles begann, ist aber mittendrin auch heute noch gut erkennbar. 2014 haben die Michel-Brüder die Firma an eine schwedische Investorengruppe verkauft. Der Standort Schiltwald stand zu keiner Zeit zur Diskussion.
Damit endet die Geschichte von der genialen Erfindung, für die es im wirklichen Leben keine Verwendung gab. Was aber Adrian Michel wohl gefreut und Hermann Burger gefallen hätte: Zur Zeit des Kalten Krieges soll sich die amerikanische CIA stark für die Brieftauben-Panorama-Kamera aus Schiltwald interessiert haben.