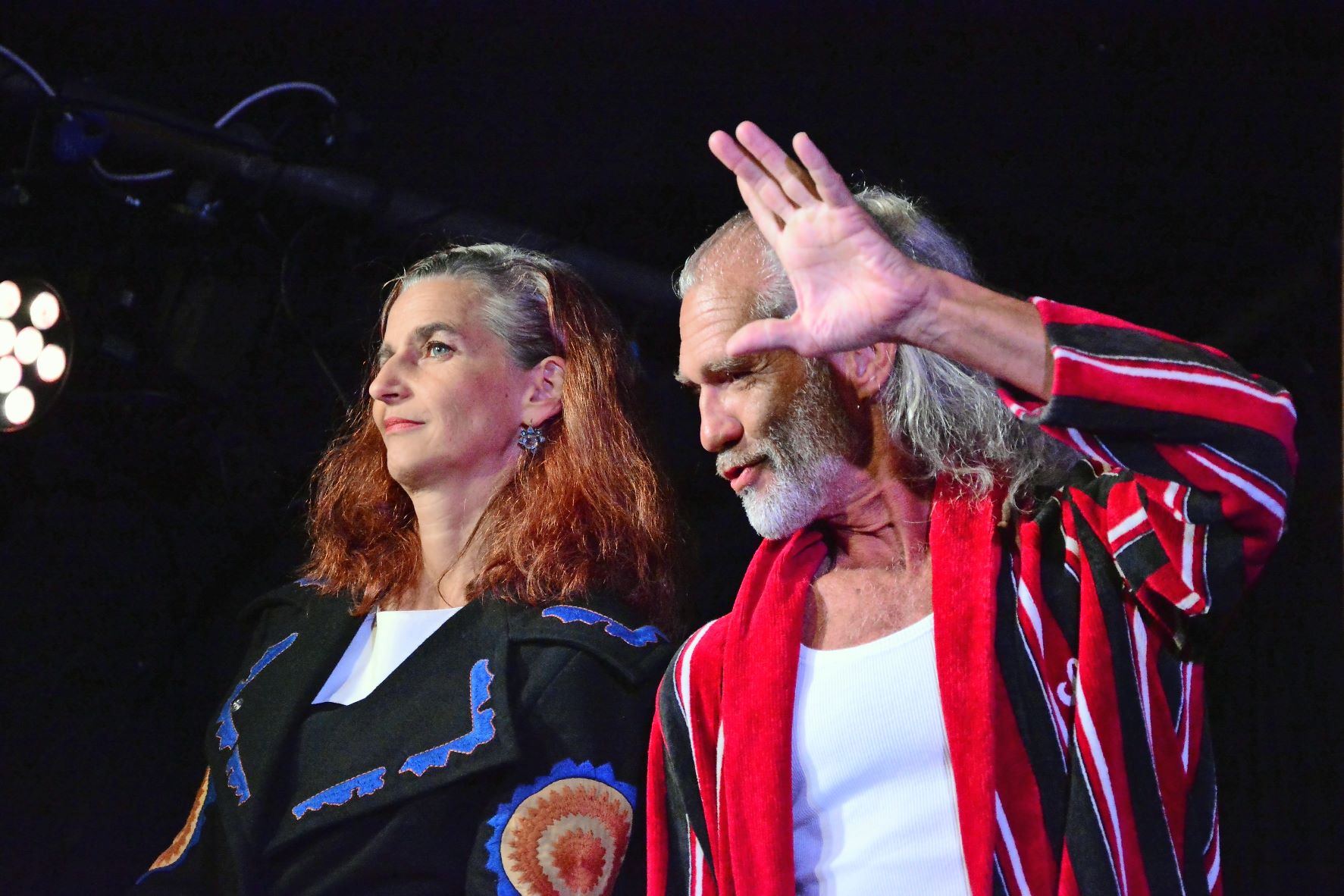Die Branche fühlt sich im Stich gelassen: «Grosskonzerte sind unter diesen Vorzeichen ein Defizitgeschäft»
Ab Oktober sollen Grosskonzerte mit mehr als 1000 Zuschauern wieder möglich sein. Sind Sie zufrieden?
Christoph Bill: Wenn man den Entscheid genauer anschaut, kann man nicht zufrieden sein. Vieles ist noch nicht geregelt und wirft gleich neue Fragen auf. Wir brauchen Planungssicherheit sowie wirtschaftlich und organisatorisch umsetzbare Massnahmen. Der Bund verfolgt seit Beginn der Krise eine Hinhaltetaktik, die nicht schön ist. Mehrfach haben wir uns anerboten, gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Wir haben Schutzkonzepte und Ausstiegsszenarien entworfen, aber wir wurden nicht angehört. Wir fühlen uns übergangen und im Stich gelassen.
Dann wurden Sie wieder nicht konsultiert?
Nicht für diesen Entscheid. Immerhin hat vor zehn Tagen ein erstes Treffen von Veranstalterverbänden mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) stattgefunden, bei dem wir unsere Position erläutern konnten und wo uns die Aufnahme des Dialogs versprochen wurde. Der Entscheid ist eine Mogelpackung. Er täuscht vor, dass wir wieder normal arbeiten können. Davon sind wir aber weit entfernt. Die allermeisten Veranstaltungen von SMPA-Mitgliedern wurden ja bereits auf 2021 verschoben. Wir haben den Eindruck, dass man einfach die Grundlage schaffen will, um EO-, Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen dauerhaft einstellen zu können.
Wie steht es mit der Planungsunsicherheit?
Die 1000er-Grenze ist zwar weg, aber die Planungsunsicherheit bleibt. Wir wissen ja noch nicht, welches die Bewilligungskriterien und die Auflagen sind, brauchen aber eine Vorlaufzeit von mindestens drei Monaten. Man kann es im besten Fall erahnen. Es kann auch sein, dass ein Kanton etwas bewilligt, aber die Bewilligung zwei Tage vor dem Event aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage oder den beschränkten Contact-Tracing-Kapazitäten wieder zurückzieht. Ersteres kann ich nachvollziehen, aber es kann doch nicht sein, dass wir nicht arbeiten können, nur weil die Kantone nicht zu tracen vermögen. Beides hat zur Folge, dass kaum neue Veranstaltungen geplant und die Bestehenden vorsorglich abgesagt werden. Alles andere wäre ein Himmelfahrtskommando und hat nichts mit unternehmerischem Risiko zu tun. Wer etwas anderes behauptet, lebt in einer anderen Welt.
Jetzt geht es darum, Schutzkonzepte zu erarbeiten. Wie könnten sie aussehen?
Wir, das heisst der Branchenverband der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter (SMPA) haben zusammen mit der Schweizer Bar und Club Kommission und dem Verband der Schweizer Musikclubs (Petzi) schon längst Schutzkonzepte erarbeitet. Wir haben auch den Kontakt zum Sport gesucht, weil wir in vielen Belangen im gleichen Boot sitzen. Ein Dialog findet statt. Ich finde, dass die Schutzkonzepte auf die Veranstaltungsart, die Location und das Zielpublikum angepasst werden müssen, aber möglichst einfach und schweizweit einheitlich sein sollen. Sonst ist es für Veranstalter wie Besucher nicht mehr überblickbar, was wo wann gilt.
Läuft es auf Sitzplätze heraus, auch an Popkonzerten?
Kurzfristig wohl ja, es sei denn, man hat eine Location, in der man Sektoren bilden kann. Aber die sind dünn gesät.
Ist das im Hallenstadion Zürich möglich?
Mit den vielen Ein- und Ausgängen ist ein Stehplatzbereich vielleicht denkbar, aber nicht einmal dort könnte dann die volle Kapazität genutzt werden.
Ist Maskenpflicht eine Option?
Unter Umständen ja, je nach Veranstaltung während der ganzen Dauer oder dort, wo die Wahrung der Distanz schwierig ist.
Lohnen sich Grosskonzerte, wenn die empfohlenen Abstände eingehalten werden sollen?
Ganz klar nein. In der Welt vor Corona wurde der Break-even bei Veranstaltungen vielfach erst bei einer Auslastung von über 90 Prozent erreicht. Coronabedingt kommen nun noch weitere Aufwendungen in personeller und infrastruktureller Hinsicht dazu, sodass eine Veranstaltung nie kostendeckend umgesetzt werden kann. Grosskonzerte sind unter diesen Vorzeichen ein Defizitgeschäft. Theoretisch dürfen wir arbeiten, aber ökonomisch ist es ruinös.
Wenn nur die Hälfte reindarf, muss halt der Ticketpreis verdoppelt werden, damit es sich lohnt.
Das ist aus meiner Sicht keine Option. Man spürt ja die Zurückhaltung beim Publikum, die durch die, meiner Ansicht nach, unsachliche Information während der letzten Monate provoziert wurde.
Was heisst unsachlich?
Man hängt alles an Fallzahlen auf, an Einzelschicksalen. Statt die absoluten Zahlen in Relation zu stellen. Soziale und wirtschaftliche Aspekte sowie der gesunde Menschenverstand werden oft gänzlich ausser Acht gelassen. Die Leute wurden verunsichert. So wird es noch lange dauern, bis sie wieder Vertrauen fassen und Events besuchen. Dabei sind gut organisierte Veranstaltungen keine Risikogebiete per se. Zudem lässt sich das Risiko in unserem Leben einfach nicht auf null minimieren. Wir stellen einen grossen Widerspruch zwischen Alltag und Event fest: Bei öffentlichen Veranstaltungen versucht man, alles peinlich genau zu regeln, wohingegen im Alltag oder bei privaten Events das Virus je länger je mehr ausgeblendet wird.
Die Veranstalter der grossen Open Airs von Glastonbury und Lollapallooza befürchten, dass es auch 2021 keine Grossveranstaltungen geben wird. Was sagen Sie dazu?
So weit darf es nicht kommen. Es muss uns gelingen, die Festivals im nächsten Jahr durchzuführen. Es geht auch um ein Stück Kultur, um ein Stück Identität in diesem Land. Nicht umsonst gehören die Open Airs zum Inventar der Schweizer Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Das dürfen wir nicht einfach preisgeben. Irgendwann muss man sich die Frage stellen, ob man die kulturelle Vielfalt in unserem Land behalten will. Es geht ja nicht einfach um Strukturerhaltung. Das Bedürfnis ist nachgewiesen. Wenn 2021 die Open Airs, Festivals und Grosskonzerte tatsächlich auch ins Wasser fallen, dann werden dies die meisten Veranstalter und mit ihnen auch eine Vielzahl von nachgelagerten Betrieben nicht überleben. Es geht in der gesamten Kulturbranche ums Überleben: In ihrer Existenz bedroht sind über 60’000 Betriebe und über 200’000 Stellen.
Ist das, was Glastonbury und Lollapallooza ansprechen, nicht vor allem ein Problem von internationalen Acts?
In diesem Umfeld ist es noch akzentuierter: Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit und der Reisebeschränkungen bzw. Quarantäneverordnungen fällt es schwer, im nächsten Jahr mit Weltstars aus Übersee zu rechnen. Da haben es Open Airs wie das Heitere in Zofingen etwas besser, weil es vor allem auf Schweizer und europäische Künstler baut. Doch auch die Situation in Europa kann eine Planung verunmöglichen. Eine Europa-Tour verträgt keine Quarantäne. Aber wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir Wege und Lösungen für 2021 finden.
Wie steht es mit der staatlichen Unterstützung?
Wir haben den Eindruck, dass die Mentalität vom Anfang der Krise, «wir lassen niemanden im Stich», sukzessive abgebaut wird. Die befristeten Arbeitsverhältnisse und Arbeit auf Abruf, zum Beispiel, sind zwei eventtypische Arbeitsformen. Bei der Kurzarbeit werden sie aber nun per 1. September ausgegrenzt. Der Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende läuft per 16. September aus. Arbeitgeber, die 2019 über 90’000 Franken Einkommen hatten, haben schon die letzten Monate nichts mehr erhalten, obwohl auch sie ihre Sozialbeiträge Jahr für Jahr einbezahlt haben. Da wird die Luft schnell dünn, wenn die Veranstaltungen weiterhin ausfallen und wir keine Einkünfte haben. Weiter haben die meisten Veranstalter noch keinen klaren Bescheid über die in Aussicht gestellte Ausfallentschädigung erhalten. Wenn diese Massnahmen tatsächlich nicht weitergeführt werden, und zwar einige Monate über das Ende der Corona-Einschränkungen hinaus, dann sehe ich wirklich schwarz für unsere Branche.