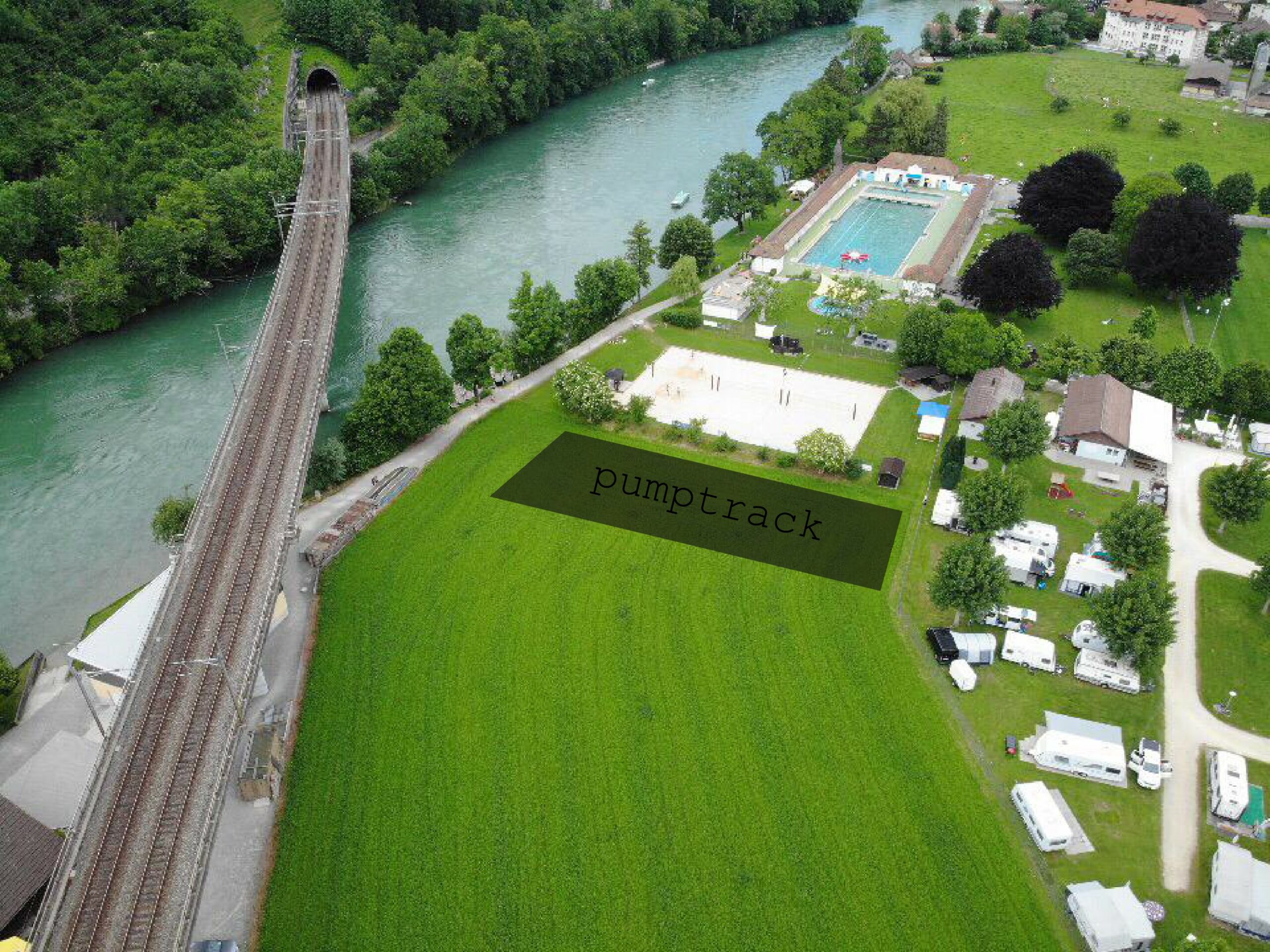Ein ewiges Licht für die Menschheit
Eigentlich galt das Thema der aktuellen Ausgabe von «Verweilen am Mozartweg» dem Konzert für Flöte, Harfe und Orchester (KV 299), entstanden während Mozarts Aufenthalt in Paris vom März bis September 1778. Günter Rumpel dehnte den Inhalt jedoch zu einem Gesamtbild über die Ausnahmeerscheinung Wolfgang Amadeus Mozart aus, gestützt auf ein umfassendes Wissen und eine Fülle von Dokumenten und Zitaten. Mit ihm stand ein berufener Referent am Pult. Rumpel war jahrzehntelang Soloflötist des Tonhalle Orchesters Zürich. Im November 1986 trat er selber als Solist im Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in Erscheinung, zusammen mit Eva Kauffungen, die in Aarburg ebenfalls anwesend war.
Einleitend erklang das mit seiner schlichten Schönheit berührende «Andantino» aus KV 299. Dann folgte ein Zitat des Pianisten Artur Rubinstein. «Die Menschheit hat ein ewiges Licht und dieses Licht ist Mozart. Solange sein Licht noch leuchtet, wird es auf der Welt nicht völlig dunkel.» Der Beweis dieser Aussage erfolgte mit der Wiedergabe des strahlenden «Exultate, jubilate» (KV 165/1773) und dem verheissungsvollen «Laudate Dominum» (KV 339/1780). Im weiteren Verlauf des Vortrages stellte der Referent Vater, Mutter und Tochter Nannerl vor, zeigte Dokumente des Aufenthaltes in Paris und befasste sich mit bekannt gewordenen Solisten von Blasinstrumenten zu Mozarts Zeit sowie den Kompositionen Mozarts, die während des Aufenthaltes in Paris und unmittelbar danach entstanden sind. Auch andere konzertante Flötenwerke verschiedener Herkunft aus diesem Zeitraum wurden zum Vergleich erwähnt.
Mozarts Verhältnis zur Querflöte
Günter Rumpel bezeichnete Mozart in seinem Vortrag als Meister der Instrumentation. Das gilt auch für die Flöte, obwohl diese nicht zu seinen Lieblingsinstrumenten gehört haben soll. Am 14. Februar 1778 schrieb Wolfgang seinem Vater Leopold: «Dann bin ich auch, wie Sie wissen, gleich stuff, wenn ich immer für ein Instrument, das ich nicht leiden kann, schreiben muss.» Die zahlreichen Flötenpassagen in seinen Werken beweisen jedoch, dass Mozart keinerlei Mühe mit der Flöte hatte. Bei den Flötenaufträgen in den Jahren 1777 und 1778 stand er stets unter Zeitdruck. Sie kamen ihm ungelegen, auch finanziell. Am Ende seines Lebens setzte er in der «Zauberflöte» seinem inneren Sinnbild ein unvergängliches Denkmal.
Der Referent bewies, dass aus historischer Sicht die Flöte das älteste Instrument der Menschheit ist. 2008 wurde in einer Höhle bei Ulm eine Flöte aus Gänsegeierknochen gefunden, datiert auf 35 000 bis 40 000 Jahre vor Christus. Auch im Manesse-Codex (1305) ist neben Gesang und Fidel auch eine Querflöte abgebildet. Weitere Varianten tauchen in der Renaissance auf. 1752 verfasste Johann Joachim Quantz eine «Anweisung die Flöte traversiere zu spielen».
Zugleich erläuterte der Referent auch die Eigenheiten und Bauweise der Harfe. Der Vortrag schloss mit Hörproben aus dem Konzert für Flöte, Harfe und Orchester ab, die deutlich zeigten, dass Mozart in ruhig dahin fliessenden Melodiebögen sehr wohl die Spezifikationen von Flöte und Harfe zum Ausdruck bringen kann.