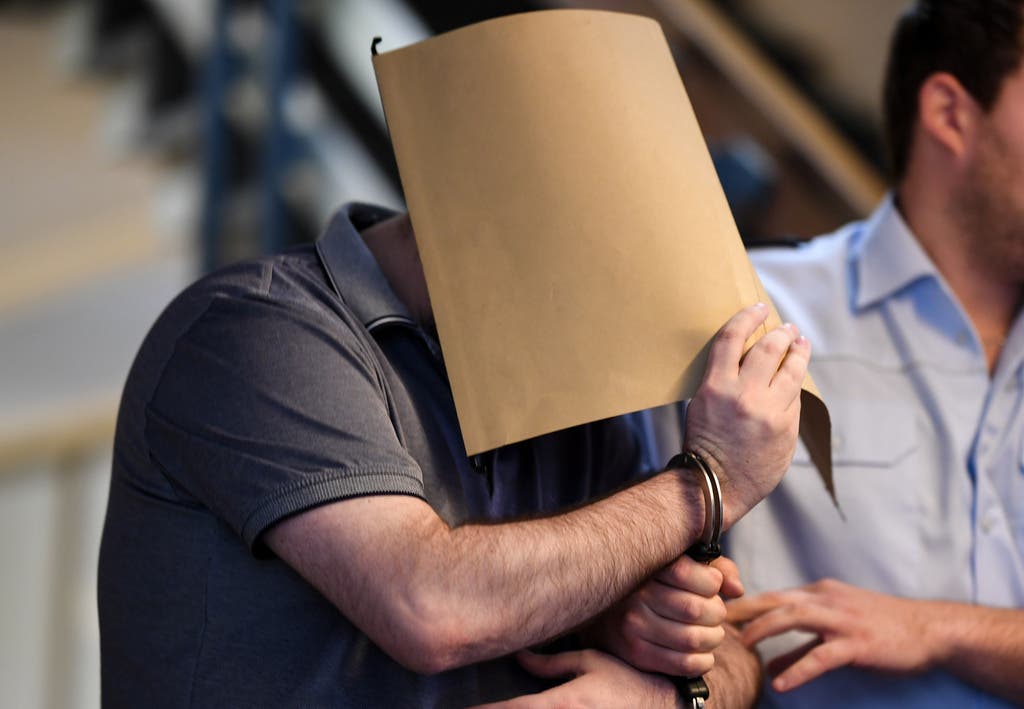Grösser, aber auch dicker: Das sind die Schweizer Kinder
Am Anfang sind wir alle gleich. Zumindest fast. Die meisten Neugeborenen sind rund 50 Zentimeter gross, allenfalls drei, vier Zentimeter kürzer oder länger. Fünf Jahre später beträgt der Unterschied zwischen den kleinsten und den grössten Kindern schon 20 Zentimeter und die Eltern, Tanten oder Lehrer sagen zum Beispiel: «Er ist halt ein Grosser!»
Damit fassen sie zusammen, worauf auch die Kinderärzte achten: Sind Kleinkinder speziell gross oder klein, dann bleiben sie es in der Regel. Weichen sie plötzlich von ihrer Wachstumskurve ab, kann das ein Alarmzeichen für eine Erkrankung sein: Magen-Darm-Probleme, Herzfehler, Asthma, Knochenerkrankungen, Nierenprobleme oder eine Schilddrüsenfehlfunktion können das Wachstum hemmen oder beschleunigen.
Speziell im Fokus ist die unterste Wachstumskurve. Diese 3. Perzentile bedeutet, dass drei Prozent aller Kinder so klein oder noch kleiner sind. Für Kinderärztinnen ist dies die Grenze der Norm: Ist ein Kind kleiner, machen sie Abklärungen. Deshalb ist es wichtig, wie genau die Wachstumskurve verläuft.
Die bisherigen Daten waren 50 Jahre alt
Nun hat das Pädiatrisch-Endokrinologische Zentrum Zürich (PEZZ) diese Kurven neu erhoben. Verwendet wurden bisher jene der Weltgesundheitsorganisation WHO oder jene von Andrea Prader. Die Daten von letzterer stammen von je 137 Schweizer Buben und Mädchen, die in den 50er-Jahren geboren wurden.
Dass beide Kurven für die Schweizer Kinder nicht, beziehungsweise nicht mehr stimmen, vermuten die Kinderärzte schon lange. Die Wachstumskurven unserer Nachbarländer deuteten darauf hin.
Die neuen Daten wurden nun von über 30000 Kindern erhoben, quer durch die Schweiz. Sie zeigen: Die Kinder sind grösser geworden. Ab dem 5. Lebensjahr, weicht die neue Kurve von den alten ab. Speziell in der Pubertät. Buben sind dann 4,2 Zentimeter grösser als früher, Mädchen 3 Zentimeter gegenüber der WHO-Kurve. Diese basiert ab dem 5. Lebensjahr auf Daten von weissen, schwarzen, hispanischen und asiatischen Kindern in den USA mit Jahrgängen 1949 bis 1968. Schwarze Kinder kommen beispielsweise ein bis zwei Jahre früher in die Pubertät und sind auch früher ausgewachsen. Die Diskrepanz zu den Schweizer Kindern vergrössert sich deshalb besonders stark zum 18. Lebensjahr hin.
Pubertät hat sich leicht vorverschoben
Die Pubertät der Schweizer Kinder hat sich aber sehr wahrscheinlich auch verändert: Das lässt der durchschnittlich rund 6 Monate früher eintretende Wachstumsschub der heutigen Kinder vermuten gegenüber jenen, die Prader vor 50 Jahren gemessen hat.
Warum dies so ist, hat die Studie nicht untersucht. Generell wird bei früher Pubertät aber angenommen, dass sie mit mehr Körperfettanteil zu tun hat, denn unter anderem im Körperfett werden wachstumsrelevante Hormone gebildet und umgewandelt.
Abgesehen von der Pubertät stimmen die WHO-Kurven in den Grenzbereichen nicht, bei sehr schweren oder sehr kleinen Kindern. Endokrinologe Urs Eiholzer vom PEZZ sagt dazu: «Die Resultate unserer Studie zeigen, dass die WHO-Kurven genau dort nicht stimmen, wo sie für die Beurteilung am wichtigsten sind. Nämlich in Bezug auf die 3. Perzentile für die Grösse und der 97. Perzentile für das Gewicht.» Das Gewicht, beziehungsweise den Bodymass-Index haben die Forscher auch erhoben.
Junge Erwachsene sind mehrere Kilo schwerer
Der BMI ist gestiegen: Gegenüber der Prader-Kurve ist ein gleich grosses 12-jähriges Mädchen heute durchschnittlich ein Kilogramm schwerer, ein 18-jähriges fast vier Kilogramm. Ein 11-jähriger Bub ist zwei Kilo schwerer, ein 18-jähriger gut sechs Kilo bei mittlerer Körpergrösse.
Da die gemessenen Kinder ihrer Herkunft und dem Millieu zugeordnet werden können, ist nun klar: Übergewicht bei Kindern hat mit der Herkunft zu tun, aber wenig mit dem Einkommen der Eltern. Mit Eltern aus Südeuropa hat ein Kind ein 2,5-faches Risiko übergewichtig zu sein. Die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht liegt bei diesen bei 31 Prozent für Jungen und bei 23 Prozent für Mädchen. Bei Schweizer Kindern liegt das Risiko bei 12 Prozent für Jungen und bei 9 Prozent für Mädchen.
Als Erwachsene sind wir heute übrigens nur wenig grösser: 1,1 Zentimeter als zwei Generationen vor uns. Der Sprung geschah in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts: Vor 120 Jahren waren die Leute in der Schweiz 15 Zentimeter kleiner.