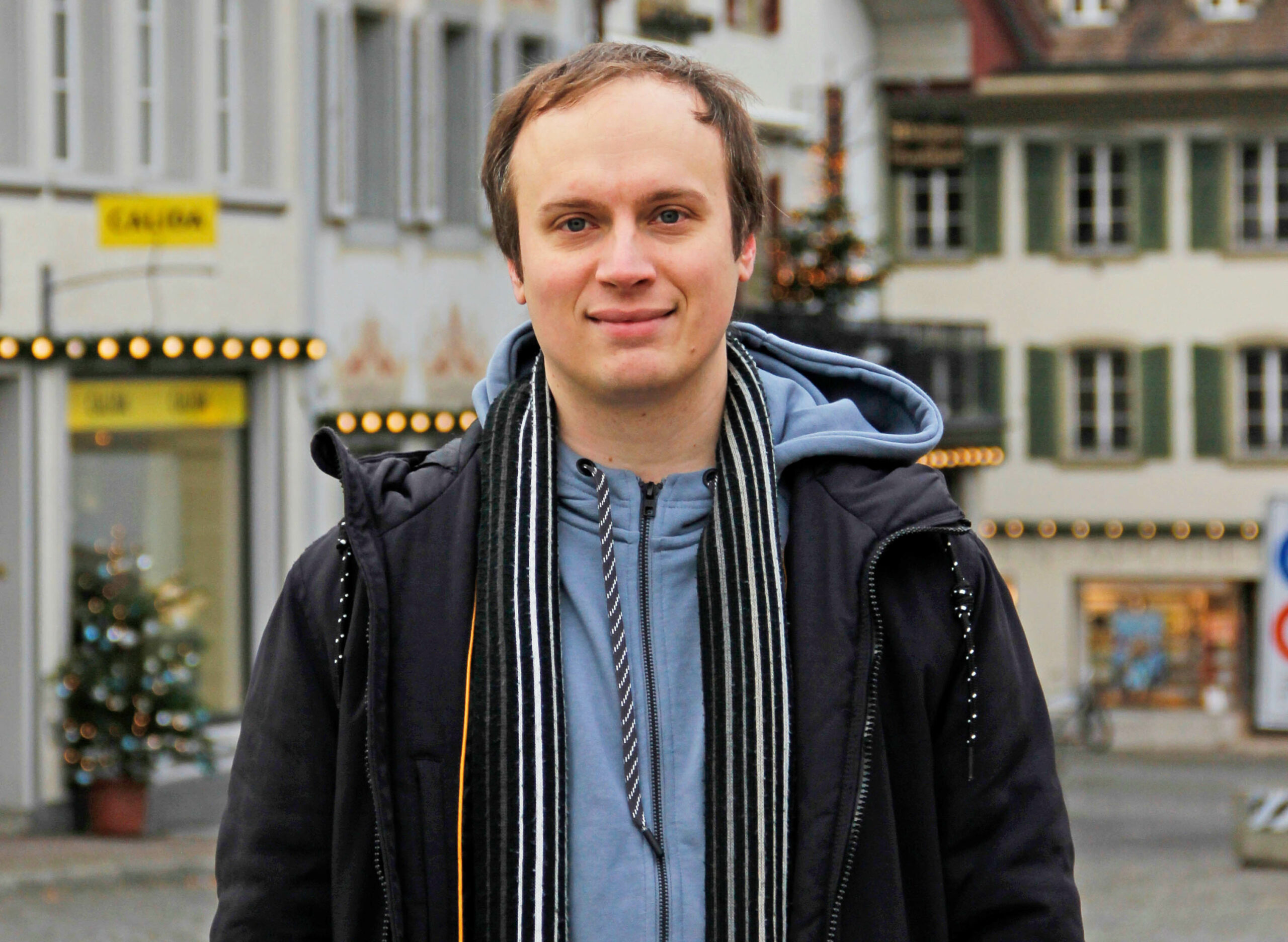«Ich habe mir einfach ein dickeres Fell zugelegt»
Frau Regierungsrätin Roth, Sie sind erst vor einigen Monaten in den Bezirk Zofingen, genauer nach Rothrist, gezügelt. Wie gefällt es Ihnen am neuen Ort? Und wie gefällt es Ihrer Katze Gaia?
Franziska Roth: Sehr gut! Ich fühlte mich von Anfang an zu Hause und bin sehr zufrieden. Auch der Katze gefällts.
Haben Sie schon viele Kontakte geknüpft?
Ich bin in regem Kontakt mit den Leuten der Ortspartei Rothrist. Sie hat mich schon im Wahlkampf sehr unterstützt, genauso wie die Bezirkspartei Zofingen. Was ich sehr schätze am neuen Wohnort, ist die Fussdistanz zum Primo-Lädeli und zur Metzgerei Koller. Da kaufe ich fast alles ein.
Wie lange ist der Arbeitstag als Regierungsrätin?
Unterschiedlich. Morgens um 7 Uhr beginnt die erste Sitzung, Lagebesprechung mit dem Generalsekretär. Zwischen zwölf bis vierzehn Stunden dauert der Tag dann schon.
Sie haben in den letzten Monaten sehr viel Kritik erfahren. Was war für Sie schwieriger: Die Einarbeitung in die Dossiers oder die Kritik von aussen?
Beides war nicht einfach. Die Einarbeitung in die Dossiers war sehr komplex und schwierig. Die Kritik in dieser Form war für mich auch neu. Ich habe mir inzwischen einfach ein dickeres Fell zugelegt; sonst ginge es gar nicht.
Wenn Sie zurückblicken: Wo fanden Sie die Kritik berechtigt? Und wo völlig übertrieben?
Schon oft übertrieben. Vielleicht war ich einerseits ein dankbares Opfer, weil ich als Quereinsteigerin gekommen bin. Andererseits war ich natürlich nicht die Wunschkandidatin der linken Seite.
Fast hat man den Eindruck, Sie seien für manche Leute eine Reizfigur, dabei sind Sie weder marktschreierisch noch drängen Sie sich in den Vordergrund. Was ist Ihre Erklärung dafür?
Der Wechsel vom Gericht in die Politik war ein Kulissenwechsel. Am Gericht war Zurückhaltung gefragt; man hört allen zu, lässt sie ausreden. Das sind Eigenschaften, die in der Politik gerade nicht gefragt sind oder falsch ankommen: Es heisst dann, man interessiere sich nicht. Dass ich mich zurücknehmen kann, hängt vor allem mit meinem beruflichen Werdegang zusammen, nicht mit meiner Person: So zurückhaltend und still bin ich nämlich gar nicht – meistens (lacht).
Hatten Sie auch mal das Gefühl, es laufe eine Kampagne gegen Sie?
Im Wahlkampf – ja. Da hat man mir buchstäblich die Worte im Mund verdreht. Ich spürte, dass man auf eine Aussage von mir wartete, an der man mich aufhängen konnte. Es waren Kräfte am Werk, mich zu verhindern. Aber ich habe den Wahlkampf überlebt – und gebe jetzt hier mein Bestes.
Den Wechsel vom Gericht in die Politik haben Sie selbst einmal als «krass» beschrieben. Was meinten Sie damit?
Am Gericht war ich mehr hinter den Kulissen, jetzt vor den Kulissen, quasi auf der Bühne. Erst im Laufe der Zeit realisierte ich auch, dass einige Leute Mühe hatten zu akzeptieren, dass ich im zweiten Wahlgang komfortabel gewählt wurde. Diese Leute griffen mich an oder versuchten an meinem Stuhl zu sägen.
Was ist Ihr wichtigster Erfolg in Ihrer bisherigen Amtszeit?
Die Einführung von «ambulant vor stationär» ist sicher ein wichtiger Meilenstein. Um die Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich zu fördern, werden seit Januar 2018 im Kanton Aargau 13 chirurgische Eingriffe vorwiegend ambulant durchgeführt. Durch dieses Konzept spart der Kanton rund fünf Millionen Franken pro Jahr – Tendenz steigend. Zudem sind die Patienten wieder schneller zu Hause. Im Vergleich zum Ausland weist die Schweiz immer noch einen sehr kleinen Prozentsatz an ambulanten Eingriffen auf. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
Welchen Erfolg wollen Sie in Ihrer ersten Amtszeit unbedingt noch verbuchen?
Unterwegs ist ja die Totalrevision des Spitalgesetzes. Die möchte ich schlank durchbringen. Ziel ist eine qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Versorgung. Das heisst auch, dass nicht alle Spitäler alles anbieten, sondern zusammenarbeiten und Synergien nutzen. Die medizinische Grundversorgung muss gewährleistet sein; wir haben aber nicht den Anspruch, Spitzenmedizin vor jeder Haustüre zu betreiben. Die Grundidee ist, dass wir im Aargau Gesundheitsregionen mit Kompetenzzentren haben, aber nicht mehr in jedem Spital alles angeboten wird. Ich setze mich zudem sehr dafür ein, dass Palliative Care im ganzen Kanton gewährleistet ist und die entsprechenden Einrichtungen die notwendige Unterstützung erhalten. Und es ist mir ein grosses Anliegen, dass sich die Hausarzt-Situation verbessert.
Sie haben den Zulassungsstopp per 1. Mai gelockert – stellen Sie schon eine Verbesserung fest?
Ja. Ich hoffe sehr, dass wir mehr Hausärzte gewinnen können und dass die Ärzte, die in nächster Zeit in Pension gehen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Damit soll die medizinische Grundversorgung auch in den Randgebieten sichergestellt sein. Und wenn ich eine Empfehlung an die Leserschaft abgeben darf …
… bitte.
Wer kein medizinischer Notfall ist, soll zunächst in die Drogerie oder Apotheke, dann zum Hausarzt und erst zum Schluss in die Notfall-Station. Viele gehen einfach in den Notfall als Alternative zum Arzt – das verursacht ein Mehrfaches an Kosten und blockiert die Notfall-Station für die echten Notfälle.
Ein Thema, das die Leute beschäftigt und für emotionale Debatten sorgt, ist das Asylthema. Wie sieht es aktuell mit den Asylzahlen aus?
Im Moment sind die Zuweisungszahlen tief. Der Aargau übernimmt 7,7 Prozent der Asylsuchenden, die in die Schweiz kommen. Im Moment sind das zwischen 60 und 70 Personen pro Monat, etwa halb so viel wie im Spitzenjahr 2015. Wir haben in den Asylunterkünften im Moment keine Platzprobleme. Aber wie es weitergeht, ist unklar.
Können Sie etwas zur geplanten Grossunterkunft im Aargau sagen? Gibt es geeignete Standorte?
Wir suchen eine Grossunterkunft im Sinne eines Pilotprojekts mit 150 bis 300 Plätzen, später sollen es vier solche Unterkünfte sein. Die Suche gestaltet sich schwieriger, als ich gehofft hatte. Alle waren ganz still. Wir waren auf allen Ebenen dran, zu suchen – und suchen immer noch. Ich bin offen für Inputs. Wir haben inzwischen einige valable Objekte im Visier; wir sind an bestehenden Bauten interessiert: leerstehenden Hotels zum Beispiel oder Bürogebäuden, in denen sich mit wenig Aufwand Zimmer einrichten lassen. Der Regierungsrat wird eine Liste von Objekten genehmigen, die infrage kommen. Dann gehen wir auf die Gemeinden zu, sie sollen sich äussern können. Wir werden nicht einfach entscheiden und dann informieren. Wir wollen die Standortgemeinden vorgängig an einen Tisch holen. Klar: Am Schluss entscheidet der Regierungsrat.
Sind Sie zuversichtlich, dass Sie bis zum Sommer 2019 einen Standort finden?
Das schon. Die Erfahrungen zeigen, dass auch grössere Unterkünfte keine Probleme machen und keine nennenswerten Störungen für die Bevölkerung verursachen. Die Betreuer sorgen für einen ruhigen und störungsfreien Betrieb, es kommen auch Angebote aus der Bevölkerung, zu helfen. Ich hoffe, dass nicht überall die totale Ablehnung herrscht, wenn wir dann auf die Gemeinden zugehen.
Ablehnend könnten sich vor allem Ihre Parteigänger äussern. Hilft es, dass Sie der SVP angehören und Ihre Leute besser überzeugen können?
Wahrscheinlich ist das schon ein Vorteil. Es geht ja nicht darum, die Leute zu überreden, sondern darzulegen, wie die Situation wirklich ist. Es ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen, alle müssen mitmachen. Ich bin der Meinung, dass wir den Hebel in Bern ansetzen müssen. Es kommen zu viele Menschen hierher, die keine echten Flüchtlinge sind. Meine Partei hat nicht Mühe mit den echten Flüchtlingen, sondern mit den Wirtschaftsflüchtlingen, die die Sozialwerke belasten. Auch mir ist es ein Anliegen, dass der Steuerzahler nicht für Leute aufkommen muss, die nicht hierhergehören. Es ist mein erklärtes Ziel, dass diese Leute nicht dableiben. Aber die Unterkunft brauchen wir – wir müssen unseren Job machen.
Die Departemente werden geflutet mit Vorstössen von Grossrätinnen und Grossräten. Wird das Instrument überstrapaziert, ja missbraucht?
Ich stelle eine Häufung zu ähnlichen oder gleichen Fragestellungen fest, meist zu Gesundheitsthemen. Die Gesundheitsabteilung ist mit der Ausarbeitung des Spitalgesetzes sehr eingespannt, die Ressourcen sind knapp. Solche Vorstösse sind einfach sehr zeitraubend. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Vorstösse eingereicht werden, um sich zu profilieren. Nächstes Jahr sind Nationalratswahlen. Meine Einschätzung wird auch von anderen Leuten geteilt: Wer ein Interesse an einem Wechsel von Aarau nach Bern hat, tut sich gern mit möglichst vielen Vorstössen hervor. Das ist für uns sehr mühsam; wir betreiben quasi Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler. Man kann uns ja auch mal ein Mail schreiben und muss nicht gleich einen Vorstoss machen. Das wurde bei mir übrigens auch schon von linker Seite mehrmals gemacht und funktioniert prima.
Sie haben sich kürzlich in einer Rede kritisch über den Journalismus geäussert. Man könne bei komplexen Themen nicht mehr auf das Fachwissen erfahrener Journalistinnen und Journalisten zählen. Hat die Kompetenz des Mediensystems gelitten?
Eine schwierige Frage. Die Themen sind komplexer geworden, bei denen manche, zum Beispiel Praktikanten, überfordert sind. Andere wollen eine sensationelle Headline. Nicht alle machen sich die Mühe, sich wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen und diese in einer verständlichen Form aufzubereiten. Die Leute haben heute aber auch mehr Mühe, Texte zu verstehen – das kommt wohl von der SMS-Kultur.
Sind Sie selber auf social media aktiv?
Nein, nicht zuletzt wegen meiner früheren Tätigkeit am Gericht. Im DGS ist unsere Kommunikationsabteilung für die Betreuung dieser Plattformen zuständig. In unserem Departement nutzen wir nach dem Grundsatz «Tue Gutes und sprich darüber» auch vermehrt social media, um den Leuten zu zeigen, dass und wie wir hier arbeiten. Wir nutzen beispielsweise die Facebook-Seite des Kantons, um gewisse Dinge direkt unter die Leute zu bringen.
Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sind ein düsteres Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Der Kanton Aargau hat das Thema aufgearbeitet und abgeschlossen. Welche Lehren müssen wir daraus ziehen?
Das Dossier hat die Opferhilfe bearbeitet. Ich habe von Mitarbeiterinnen die eine oder andere unglaublich traurige und schlimme Geschichte gehört. Ich habe mich gefragt, was das für Leute sind, die damals verantwortlich waren – so lange her ist es ja noch nicht. Es ist einfach nicht gut, wenn der Staat zu viel in Familienstrukturen eingreift, ausser, wenn strafbare Handlungen vorliegen. Ich hoffe, dass die Aufarbeitung für die Betroffenen hilfreich war.
Vorletzte Frage: Schauen Sie sich die Fussball-WM an?
Ich schaue nicht viel fern, und Fussball ist nicht gerade mein Sport. Das Spiel Schweiz – Serbien schaue ich mir aber an, mit meinem Sohn. Das Essen habe ich so organisiert, dass wir vor dem Fernseher essen können. Und dann schaue ich vielleicht noch den Final.
Letzte Frage: Wer wird Fussball-Weltmeister – falls es die Schweiz nicht wird?
Ich zähle auf die Schweizer!
Franziska Roth (Jahrgang 1964) besuchte die Handelsmittelschule in Liestal, absolvierte berufsbegleitend das staatliche Abendgymnasium und studierte anschliessend Rechtswissenschaften an der Universität Basel. 2002 bestand sie die Aargauer Anwaltsprüfung. Zwischen 2001 und 2005 arbeitete sie auf der Baudirektion Kanton Zürich als juristische Sekretärin, danach folgte eine selbstständige Anwaltstätigkeit in Zug und Rheinfelden. Zwischen 2008 und 2010 war sie Präsidentin des Arbeitsgerichts Brugg, ab 2010 bis zu ihrer Wahl in den Regierungsrat Präsidentin des Bezirksgerichts Brugg. Zwischen 2009 und 2012 sass sie für die SVP im Brugger Einwohnerrat. 2011 kandidierte sie für den Nationalrat. Im Frühjahr 2016 nominierte die SVP Roth als Regierungsratskandidatin – noch bevor klar war, dass Susanne Hochuli (Grüne) zurücktreten würde. Im ersten Wahlgang am 23. Oktober verpasste sie das zur Wahl nötige absolute Mehr. Im zweiten Wahlgang wurde sie mit deutlichem Vorsprung gewählt.