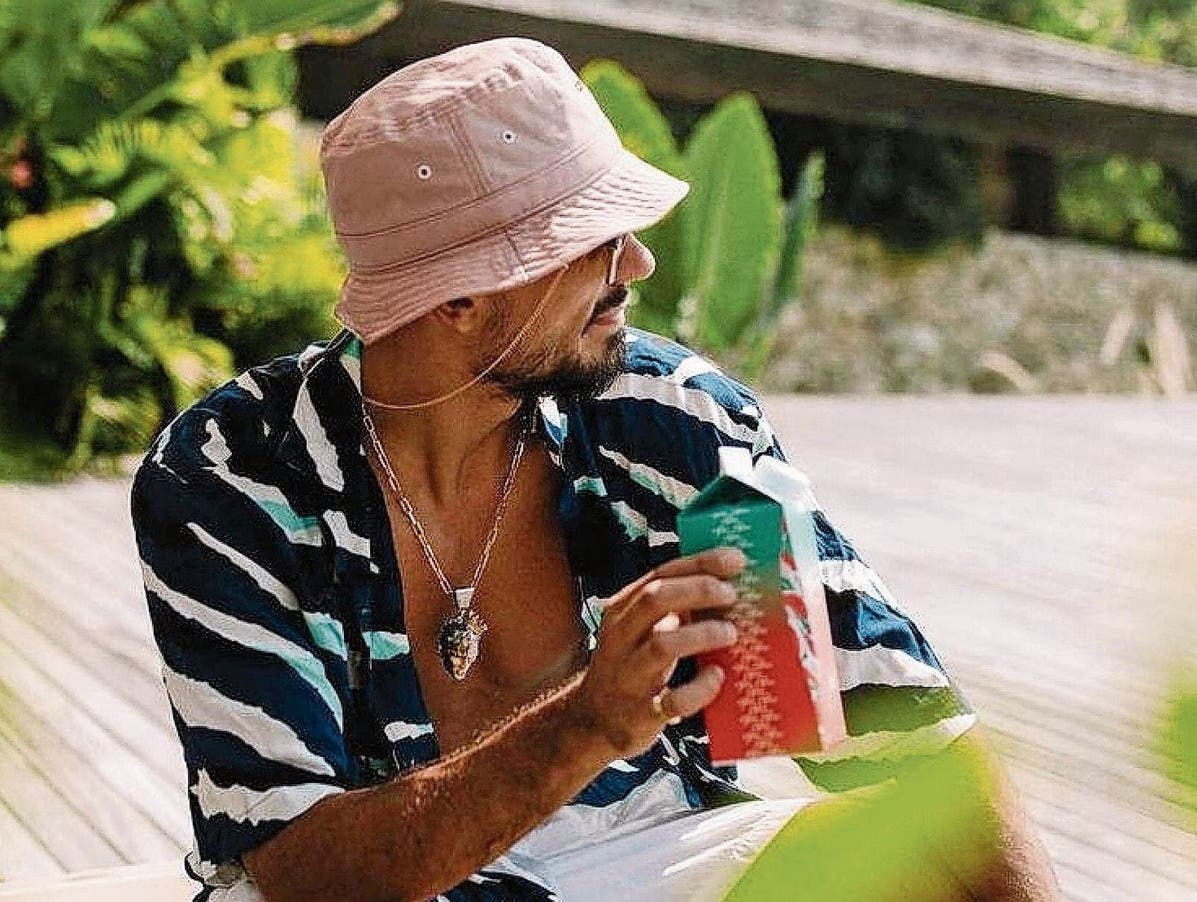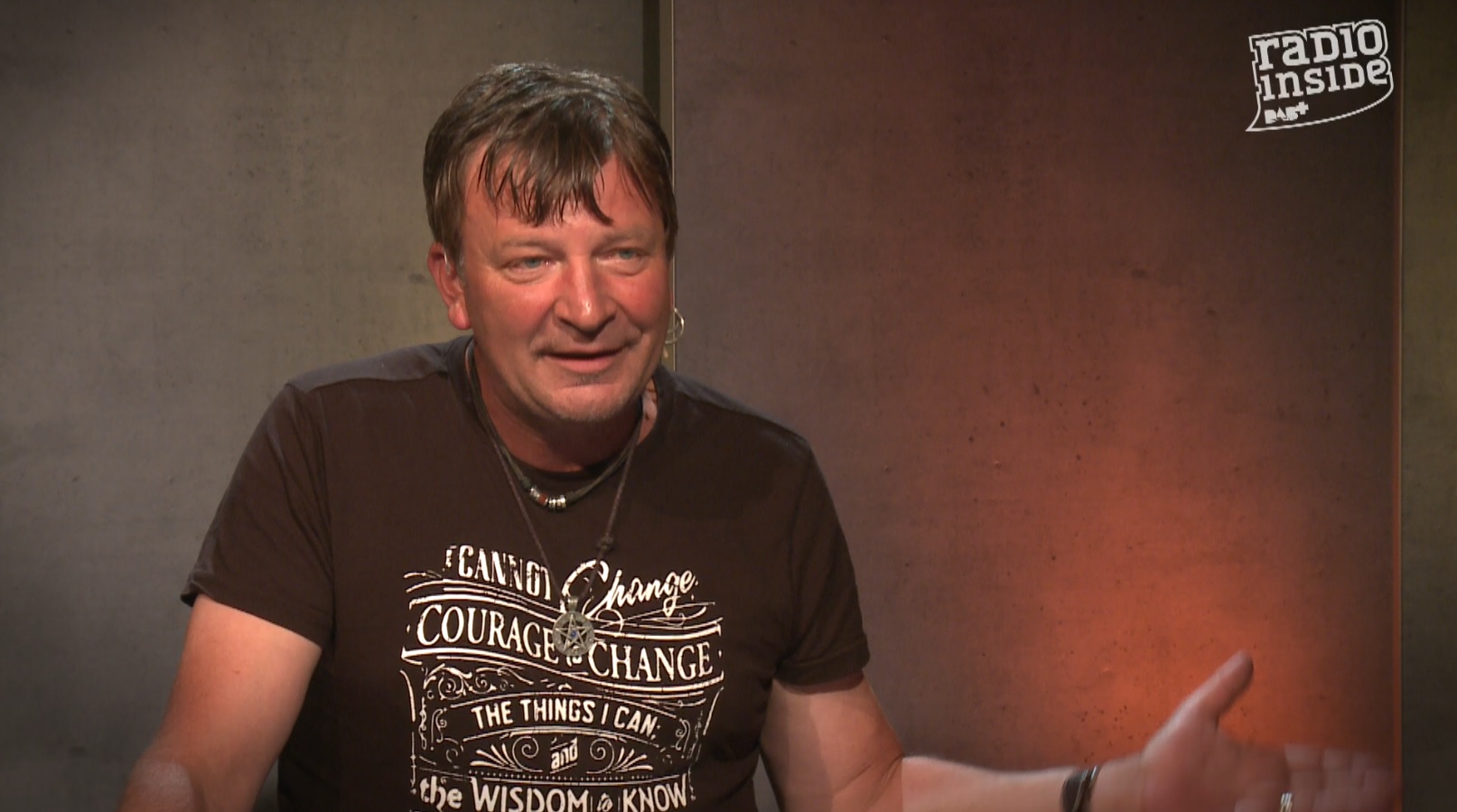Jurist lässt Computer alle möglichen Melodien zusammenstellen und behauptet: Streitereien übers Urheberrecht sind absurd
Rock’n’Roll löste in den 1950er-Jahren die Revolution jener Kunstform aus, die wir heute im weitesten Sinne als Popmusik bezeichnen. «Popmusik» ist überall. Sie steckt in Rock, Metal, Hip Hop, Disco, Electronic, Punk oder Reaggae. Hunderte Millionen Songs und Melodien hat die Menschheit bereits geschrieben, Millionen neue Melodien und Songs kommen jährlich hinzu. Kein Wunder, gibt es immer wieder Kompositionen, die sich sehr ähneln. Dies führt regelmässig zu urheberrechtlichen Streitereien. In den vergangenen Jahren beispielsweise um Marvin Gaye gegen Ed Sherran oder Tom Petty gegen Sam Smith.
Jüngstes Beispiel auf internationalem Level war 2019 der Knatsch zwischen der kalifornischen Sängerin Katy Perry und dem christlichen Rapper Flame. Dieser beschuldigte Perry, drei Töne aus seinem Song «Joyful Noise» für ihren Hit «Dark Horse» «gestohlen» zu haben. Perry beteuerte vor Gericht, «Joyful Noise» sei ihr völlig unbekannt gewesen. Das Gericht sah es anders: Es verurteilte Perry wegen Plagiat zu 2,8 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Argumentation: Perry hätte Flames Song kennen müssen, da er populär genug sei.
Für den amerikanischen Musiker und Juristen Damien Riehl klingt das wie ein Witz. Auf Youtube, Soundcloud, Spotify und anderen Plattformen gebe es bereits Hunderte Millionen Songs. Niemand könne alle Songs kennen, auch Künstler nicht. «Songschreiben und Veröffentlichen gleicht deshalb dem Gang über ein Minenfeld», erklärte er kürzlich in einem TEDx-Talk in Minneapolis. Monatlich kämen Millionen neue «melodiemässige Landminen hinzu».
Milliarden Melodien in die Gemeinfreiheit
Um dieses Minenfeld zu beseitigen und das seiner Ansicht nach «kaputte Urheberrecht» zu reparieren, hat Riehl mit dem Programmierer Noah Rubin einen Algorithmus entwickelt. Dieser berechnete die möglichen 8 hoch 12 Variationen jener acht in der Popmusik am häufigsten verwendeten Stammtöne zu jeweils zwölf Tönen langen Melodien. Nach sechs Tagen Rechenzeit erzeugte der Algorithmus 68,7 Milliarden Melodien.
Die Sammlung beinhaltet sämtliche existierenden, sowie alle bisher noch nicht von einem Menschen verwendeten Tonfolgen. Riehl und Rubin stellten die Milliarden Melodien vor einigen Tagen als computerlesbare Midi-Daten – einem Standardformat in der Musikproduktion zum Austausch von Klängen und Melodien zwischen Computer und elektronischen Musikinstrumenten – unter die gemeinfreie Public Domain-Lizenz ins Internet. Auf allthemusic.info kann das 2,6 Terabyte grosse Datenpaket kostenlos und frei zugänglich heruntergeladen werden.
Weil Melodien rein mathematisch funktionierten, gelten sie universell und deshalb habe niemand Anrecht auf ihr Urheberrecht, so die Argumentation. «Für einen Computer ist die Tonfolge ‹do re mi re do› lediglich eine Zahlenreihe von 1 2 3 2 1», erklärt Riehl. Philosophisch betrachtet existierten Melodien deshalb seit dem Anbeginn der Zeit und seien folglich von einer höheren Macht erschaffen worden. Deshalb könnten Melodien von uns Menschen nicht «erfunden», sondern lediglich «entdeckt» werden.
Konsequenzen für das Urheberrecht
In den kommenden Tagen sollen weitere Milliarden Tonfolgen ins Netz gestellt werden. Das Ziel ist es, sämtliche Melodien, die mit einer Klaviatur von 88 Tasten erzeugt werden können, in die Gemeinfreiheit zu geben. Somit fielen auch Jazz und Klassik unter Public Domain.
Thomas Hartwig, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft Schweiz, sieht Parallelen zu Johann Sebastian Bach. Wissenschaftliche Untersuchungen von fünf oder sieben Tönen in den Werken des Komponisten aus dem 18. Jahrhundert hätten gezeigt, dass sich seine Melodiebruchstücke bis heute in zahlreichen Musikstücken wiederfinden. «Daher liegt der Schluss nahe, dass diese zur Gemeinfreiheit gehören, da heute ja das ganze Werk von Bach gemeinfrei ist.»
Zumindest für die Schweiz dürfte die Gemeinfreiheit der Milliarden Melodien keine Auswirkungen haben, glaubt Hartwig. «Beim Schweizer Urheberrecht geht es um den ‹individuellen Charakter› eines Werks und um das ‹Kopieren› – also das Darbieten und Zugänglichmachen – ohne Einwilligung der Urheber.»
Können Computer keine Urheber sein?
Den Zustand völligen Friedens und Einigkeit unter Urhebern, weil nun alle Melodien gemeinfrei seien, bezweifelt auch Giorgio Tebaldi von der Suisa, die in der Schweiz die Nutzungsrechte von Künstlern vertritt. «Werke, die durch einen Computer erschaffen werden, sind urheberrechtlich grundsätzlich nicht geschützt», so Tebaldi. Ein Werk könne nur von einem Menschen erschaffen werden. Anders sehe es bei Werken aus, die von einer künstlichen Intelligenz kreiert würden. Sobald ein Mensch eine KI als Instrument oder Werkzeug benutze, seien solche Werke urheberrechtlich geschützt. Nur, handelt es sich beim Algorithmus von Riehl und Rubio nicht auch um eine KI? Ist der Algorithmus ein Instrument oder lediglich ein «simples Programm»? Wo liegt die Grenze?
Möglichkeiten regen philosophisches Denken an
Der Berner Christoph Trummer ist Musiker und Leiter der politischen Projekte beim Verband SONART – Musikschaffende Schweiz. Ihm ist bewusst, dass viele Melodien sich ähneln. «Als Singer-Songwriter ist es mir auch schon passiert, dass ich eine Tonfolge benutzt habe und ich dann bemerkte, dass es die in gleicher Form schon gibt.» Das könne unbewusst passieren, obwohl man beim Komponieren nicht daran denke. Solche Songs seien trotzdem eigenständige Werke. Ein Werk sei mehr als die Folge einzelner Töne: «Es ist das Zusammenspiel von Akkorden, einem Text, einer Stimmung sowie der Zeit und Persönlichkeit, die ein Künstler investiert hat.»
Auch wenn «All the Music» Urheberrechtskonflikte in absehbarer Zeit wohl nicht aus der Welt zu schaffen vermag oder sogar als künstlerischer und gesellschaftlicher «Hack» verstanden werden kann, könnte die Aktion vielleicht eine längst überfällige Diskussion über künstlerische Freiheit, Schöpfungshöhe und die Absurdität von Millionenklagen bewirken.