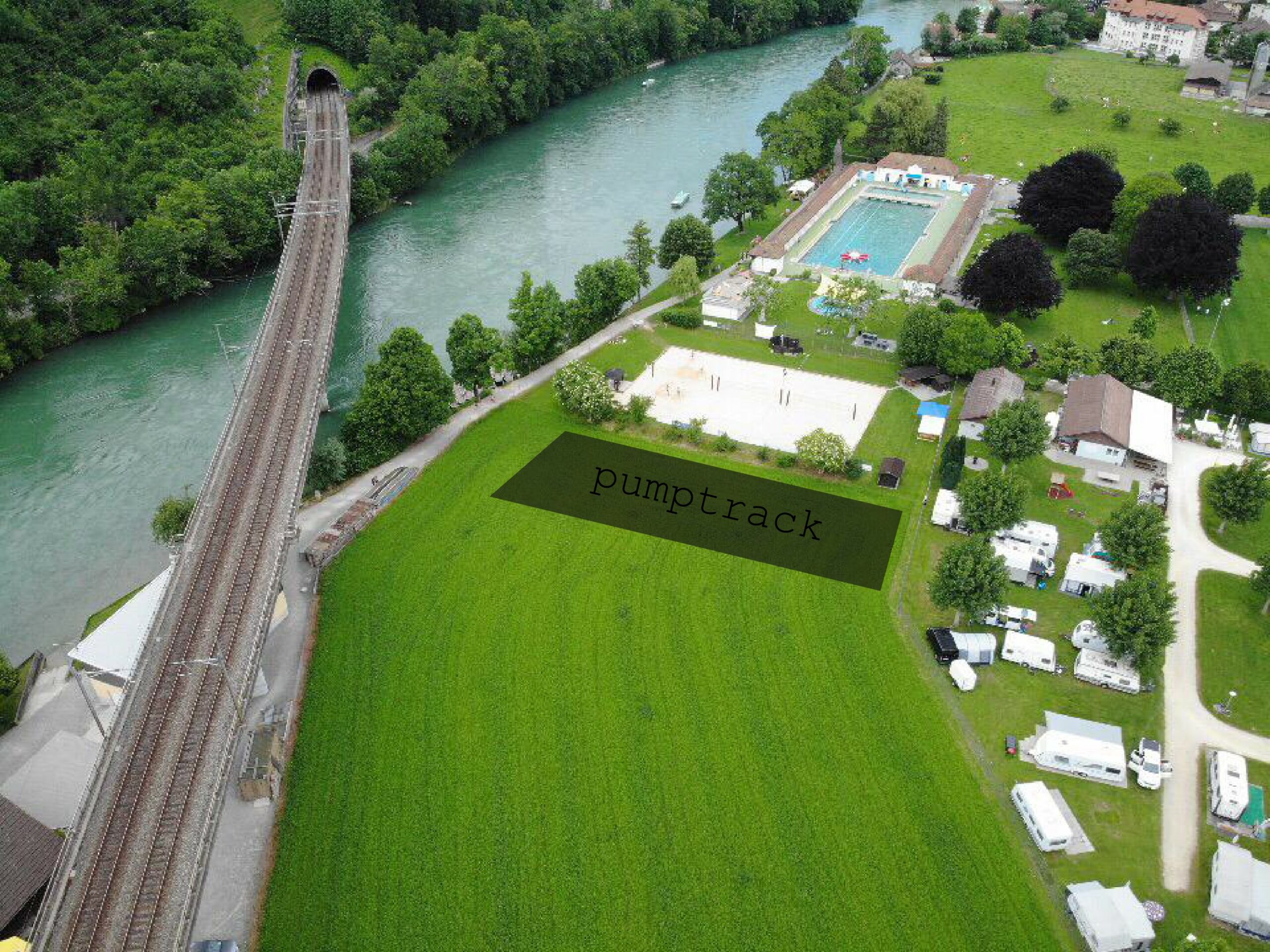Martina Bircher: «Wir benachteiligen unsere eigenen Leute»
Die Aarburger Sozialvorsteherin Martina Bircher (SVP) hat in ihrem ersten Jahr als Grossrätin über ein Dutzend Vorstösse eingegeben oder mitgetragen. Mit «Motivation statt Sanktion in der Sozialhilfe» griff sie bereits nach einem heissen Eisen und will die Sozialhilfe um fast ein Drittel auf das Existenzminimum kürzen. Per Fraktions-Motion will ihre Partei ausländische Sozialhilfeempfänger schneller ausschaffen und jetzt fordert die umtriebige 33-Jährige, die freie Wohnungswahl von anerkannten Flüchtlingen zu beschneiden. Damit soll auch die hohe Sozialhilfequote Aarburgs weiter gesenkt werden können und die Last auf die Gemeinden verteilt werden. Lokal könnte eine andere Idee demnächst aufrütteln. Dann, wenn die Gemeinde Gammel-Liegenschaften wie den «Burghof» kaufen möchte.
Martina Bircher, in Aarburg leben ungleich viele Flüchtlinge, mehr als neun von zehn sind von der Sozialhilfe abhängig. Warum wollen Sie das unbedingt ändern?
Martina Bircher: Die hohe Flüchtlingszahl kostet die Gemeinde nicht nur jedes Jahr rund 2,5 Millionen Steuerfranken. Sie verursacht auch Probleme bei der Betreuung, in Familien mit der Erziehung, in Schulen, mit den Wohnsituationen und andere mehr.
Können Sie das ausführen?
Ein Fehler der Vergangenheit war, die Flüchtlingsbetreuung an die Caritas auszulagern, die vor allem dann profitiert, wenn möglichst viele abhängige Flüchtlinge in der Gemeinde sind. Deshalb haben wir diesen Vertrag Ende 2016 aufgelöst. Zweitens haben wir immer mehr Fälle für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, rund 15 Prozent der Eritreer haben einen Erziehungsbeistand. Drittens gibt es eine stattliche Anzahl an Liegenschaften, die mittlerweile irgendwelchen auswärtigen, dubiosen Firmen gehören, die diese an Sozialhilfeempfänger und eben an Flüchtlinge vermieten. Von alleine wird das auch nicht aufhören.
Gegen dieses dubiose Wohnungs-Geschäftsmodell kämpfen Sie nach wie vor. Doch warum nennen Sie
es dubios? Illegal ist es nicht.
Weil die Vermieter Menschen in Notlagen ausnützen und den Staat schröpfen. Sie pressen finanziell die Zitrone aus, die Menschen sind ihnen egal.
Mit diesem Vorwurf sehen Sie sich auch selber konfrontiert. Beispiel ehemaliger Gasthof Burghof, wo ebenfalls Flüchtlinge wohnen: Da hat die Gemeinde das Mietgeld für die Studios auf 500 Franken gesenkt, womit die Flüchtlinge die Differenz zur effektiven Miete selber tragen müssen. Und zwar vom Existenzminimum, das dafür nicht gedacht ist. Das ist ein Sparen auf dem Buckel der Benachteiligten.
Nein, es steht jeder Person frei umzuziehen oder beispielsweise eine Wohngemeinschaft zu gründen. Und wir haben auch noch ganz viele andere Sozialhilfeempfänger in Aarburg, die in einer Wohnung wohnen, die mehr kostet als unsere Mietzinsrichtlinien es vorgeben. Ich sage: Wenn jemand jeden Monat noch 100 bis 200 Franken selber an die Miete zahlen kann, könnte man die Sozialhilfe ja auch um diesen Betrag kürzen, dann braucht es den ja gar nicht. Für mich persönlich ist die Sozialhilfe zu hoch bemessen. Daher habe ich letztes Jahr zwei Motionen eingereicht, die noch hängig sind.
Sie machen es sich doch recht einfach. Sucht man heute online in Aarburg eine Wohnung für 500 oder 600 Franken, dann findet man kein einziges Inserat.
500 Franken sind ja nur für Einzelzimmer ohne Küche und Bad.
Wie im früheren Gasthof Burghof …
Aber für eine richtige Wohnung hat eine Person 700 Franken zugut. Wir überprüfen die Mieten regelmässig. Wir erhalten ab und zu Klagen von Sozialhilfeempfängern, die mit Mietzinsrichtlinien nicht einverstanden sind. Da können wir aber jedes Mal belegen, dass es Wohnungen zu diesem Preis gibt. Man muss auch sehen, dass der Sozialhilfeempfänger auch ausserhalb seiner Wohngemeinde suchen muss.
Geht es darum, die Armen in eine andere Gemeinde abzuschieben?
Nein, das gleicht sich stets wieder aus.
Es wird hin- und hergeschoben?
Es kann sein, dass in Aarburg in einem Monat nur teurere Wohnungen zur Miete sind und dafür in Rothrist mehr günstige. Drei, vier Monate später ist es dann genau umgekehrt. Darum gleicht es sich aus. Ich habe aber auch noch nie erlebt, dass ein Sozialhilfeempfänger, der in einer zu teuren Wohnung lebt, deshalb in eine günstigere Wohnung gezügelt wäre. Er zahlt die Differenz lieber selber. Wieder ein Indiz, dass die Sozialhilfe zu hoch ist.
Oder die Leute akzeptieren einfach schmerzhafte Einschnitte, weil sie ihr Umfeld und ihr langjähriges Zuhause nicht aufgeben wollen.
Es ist ja jedem selber überlassen, wie er das Geld einsetzt. Das Gesetz lässt da keine Verwendungsvorschriften zu.
Im Zusammenhang mit Ihrer neuesten Interpellation im Grossen Rat «betreffend Geschäftsmodell mit der freien Wohnungswahl für anerkannte oder vorläufig aufgenommene Flüchtlinge» sagen Sie, es wäre für eine Gemeinde gut, derlei Liegenschaften zu kaufen und abzureissen. Ist das nicht utopisch? Die Gemeinde hat kein Geld für derartige Ausgaben.
Es gibt Gebäude, die unsere Steuerzahler rund 400 000 Franken jährlich kosten. Wir zahlen Miete, Krankenkasse, Sozialhilfe, Personalkosten für Administration und Sozialarbeit. Hinzu kommen situationsbedingte Leistungen, die wir ebenfalls tragen.
Ein Kauf würde sich rechnen?
Meiner politischen Meinung nach ja.
Den «Burghof» zu kaufen, das ist offenbar ein Thema für den Gemeinderat.
Dazu kann ich nichts sagen.
Aber die aktive Liegenschaftssteuerung durch Kauf wäre ein probates Mittel Ihrer Meinung nach?
Für Gemeinden mit hohen Soziallasten durchaus. Laufenburg hat sich vom Souverän ein Budget von 20 Millionen geholt für die Aufwertung der Altstadt und dem damit verbundenen Entfernen dieser Art von Geschäftsmodell.
So würde eine Gemeinde aktiv in den Liegenschaftsmarkt eingreifen. Dafür muss man Steuergelder ausgeben. Wie rechtfertigen Sie das als bürgerliche, liberale Politikerin?
Auch stark belastete Gemeinden sollen aktiv ihren Liegenschaftsmarkt steuern können. Es handelt sich ja um Investitionen in die Zukunft, welche amortisiert würden. Oftmals fehlen aber gerade belasteten Gemeinden die finanziellen Mittel dafür, wodurch noch mehr solche Geschäftsmodelle entstehen und damit die Belastung zunimmt – ein Teufelskreis.
Damit der Gemeinderat Liegenschaften kaufen kann, eben so wie in Laufenburg, bräuchte es aber eine Änderung der Gemeindeordnung. Wird der Souverän dieses Jahr darüber abstimmen können?
Über die Strategie des Gemeinderates Aarburg kann ich mich nicht äussern.
Eine andere Möglichkeit wäre Ihrer Meinung nach das Anmieten einer Liegenschaft, um diese an Flüchtlinge weiterzuvermieten. Dazu müsste die freie Wohnungswahl eingeschränkt werden.
Sehen Sie: Heute wohnt ein Teil der Flüchtlinge zum Beispiel im Burghof und jeder hat ein Zimmer und einen Mietvertrag. Wenn man die Wohnungswahl einschränken könnte, könnte die Gemeinde ein Gebäude anmieten, vielleicht für 2000 oder 3000 Franken und danach 20 Flüchtlinge unterbringen. 3000 Franken durch 20 Flüchtlinge ist auf jeden Fall günstiger, als wenn jeder Flüchtling einen Mietvertrag à 600 Franken für ein Zimmer unterschreibt. Zweitens könnte man die Unterbringung steuern. Der Kanton könnte sagen: Aarburg ist sehr belastet und wir wollen nicht, dass in einer Gemeinde von einer Flüchtlingsnationalität alle an einem Ort wohnen, sondern sie besser verteilen. Das wäre für die Integration besser und wirkt Ballungen entgegen. Man könnte die einen Gemeinden entlasten und andere mehr in die Verantwortung nehmen.
Kommunale Asylzentren quasi?
Hier ist ein dritter Punkt wichtig: Ich möchte die freie Wohnungswahl ja nur einschränken, solange jemand von der Sozialhilfe abhängig ist. Es wäre also eine Motivation für die Leute, schneller selbstständig zu sein und selbstbestimmter leben zu können.
Das sind nachvollziehbare Ideen. Wo sind die Hürden?
So wie ich unsere Kantonsregierung kenne, wird man sich wieder auf die Genfer Flüchtlingskonvention beziehen: Flüchtlinge seien Einheimischen gleichgestellt, wir dürfen das aufgrund internationaler Verträge nicht machen et cetera, et cetera.
Welche Szenarien haben Sie für die Antworten der Regierung?
Wenn das Argument der internationalen Verträge wiederkommt, das auch bei der Höhe der Sozialhilfe immer vorgeschoben wird, dann müsste ich rückfragen: Wir haben heute ein Sozialgesetz, wo Einheimische schlechter gestellt sind gegenüber Flüchtlingen, beispielsweise bei einer Erbschaft wegen der Rückerstattung der Sozialhilfe oder bei Verwandtenunterstützung. Wir haben folglich schon eine Ungleichbehandlung im System: Wir benachteiligen unsere eigenen Leute. Dann muss man halt auch einmal darüber nachdenken, ob die Genfer Flüchtlingskonvention nicht nachverhandelt und aktualisiert werden müsste. Die Situation ist heute ganz eine andere als nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Gegensatz zu damals haben wir heute einen ausgebauten Sozialstaat, der einst als letztes Auffangnetz für die einheimische Bevölkerung gedacht war. In Österreich etwa will man die Sozialhilfe für Flüchtlinge jetzt explizit unter jene für Heimische senken. Österreich hat die Flüchtlingskonvention auch unterschrieben …
In einem weiteren Vorstoss fordert die SVP-Fraktion eine konsequentere Anwendung des Ausländergesetzes: die konsequentere Ausschaffung von Ausländern, die Sozialhilfe beziehen. Der Kanton Aargau handhabt dies mit Samthandschuhen, müsse rigoroser werden.
Es ist eine Tatsache: Der Kanton und insbesondere das Amt für Migration und Integration – kurz MIKA – machen nichts. 2016 wurden im ganzen Kanton lediglich zwei Aufenthaltsbewilligungen aufgrund von Sozialhilfeabhängigkeit entzogen. Das ist ein Witz, wir haben ein Ausländergesetz, das nicht angewendet wird! Jeden, der das nicht glaubt, den lade ich gerne nach Aarburg zum Sozialdienst ein. Dann sieht er, welche Verfügungen ich an einem einzigen Tag unterschreiben muss. Ein aktuelles Beispiel: Ein Serbe, der seit drei Jahren in der Sozialhilfe ist, hat in Serbien ein Kind und nun dessen Mutter geheiratet. Jetzt darf die Frau mit dem Kind einreisen und auf einen Schlag sind einfach drei statt einer Person in der Sozialhilfe. Was macht das MIKA? Anscheinend schon Ausländer aus Drittstaaten in unsere Sozialhilfe importieren statt auszuweisen.
In der Gemeinde ist aber vermehrt Kritik an Ihrem harten Kurs zu hören. Übertreibt es Martina Bircher?
Das ist für mich mehr eine Bestätigung, dass ich den Job gut mache. Nur wer nichts macht, hat keine Kritiker. Man darf nicht vergessen, dass viele Leute am Sozialwesen gut verdienen, wenn dann jemand dieses System bekämpft, schafft man sich nicht nur Freunde. Wenn ich zehn Verfügungen habe pro Woche, von denen acht Ausländer betreffen, wovon sechs solche sind, die man eigentlich ausschaffen könnte, ist das tragisch. Ich beobachte auch immer mehr Langzeitbezüger, die bereits Sozialhilfeschulden von über 300 000 Franken haben und noch immer in der Schweiz sind. Wir hätten die gesetzlichen Grundlagen, sie werden aber nicht angewendet. Deshalb will ich mich 2018 vermehrt um diese Problematik kümmern.
Warum ganz genau?
Es wird viel zu wenig darüber berichtet, dass neben der Asylpolitik auch die Personenfreizügigkeit Negativfolgen auf unsere Sozialwerke hat. Wir sind auf dem besten Weg unsere Sozialwerke an die Wand zu fahren. Dabei denke ich nicht nur an die Sozialhilfe, sondern auch an die Ergänzungsleistung. Viele Personen, welche heute über die Personenfreizügigkeit in unser Land kommen, werden später einmal massive Lücken in der Altersvorsorge haben. Die Ausgaben für Ergänzungsleistung werden dadurch weiter markant steigen.
Wäre es bei den Wohnungen nicht eine sanftere, fairere Variante, die Leute aktiv bei der Wohnungssuche zu unterstützen, sie bei Verhandlungen und Problemen mit dem Vermieter zu unterstützen?
Bei uns werden die Sozialhilfebezüger jährlich aufgefordert, ihren Vermieter darauf hinzuweisen, wenn beispielsweise die Miete dem Referenzzinssatz angepasst werden soll.
Was aber, wenn die Klienten das alleine nicht schaffen?
Wenn jemand Hilfe braucht, sind unsere Mitarbeiter schon da.
Auch, um bei der Suche nach einer gleichzeitig günstigen und guten Wohnung zu helfen?
Das ist nicht unsere Aufgabe. Was viele vergessen: Das sind normale, mündige, selbstständige Menschen. Schliesslich überweisen wir das Mietgeld auch den Klienten, und nicht dem Vermieter direkt, ausser bei Drogen- oder Alkoholabhängigen.
Wenn die Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge so normal, mündig und selbstständig sind, wie Sie sagen, warum soll man ihnen dann vorschreiben, wo sie zu wohnen haben?
Diese Forderung soll nur für Flüchtlinge gelten und wird bei den vorläufig aufgenommenen Ausländern übrigens schon jeher angewendet. Gemäss Bund handelt es sich ja dabei um Personen, die an Leib und Leben bedroht sind, diese sollten entsprechend dankbar sein für den gewährten Schutz. Ob sie selber eine Wohnung aussuchen können oder nicht, darf keine Rolle spielen.
Dass Aarburg trotz hohen 5,2 Prozent nicht mehr die höchste Sozialhilfequote des Kantons hat, zeigt Ihren Erfolg. Wie werten Sie diese Entwicklung selber?
Dahinter steckt ein grosses Stück harte Arbeit. Angefangen hatte das mit der eigenen Betriebsanalyse unseres Sozialdienstes. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Ich persönlich finde mich übrigens gar nicht so streng. Für mich müsste die Schraube noch mehr angezogen werden.
Sie meinen, das Gesetz auf Kantonsstufe müsste fordernder werden?
Das heutige System, und das sehe ich durch meine Praxiserfahrung, lässt es zu, dass die Sozialhilfe ausgenutzt werden kann. Meiner Beobachtung nach gibt es immer mehr Leute, die unser System missbrauchen, sich nicht bewegen, nichts leisten und den Staat schröpfen.
Deshalb setzt Aarburg auch regelmässig Sozialdetektive ein.
Ja. Und meine Erfahrung ist, dass 20 bis 30 Prozent die Sozialhilfe auf irgendeine Art ausnützen. Die Meisten davon bewegen sich in einer Grauzone, sodass man als Behörde mehr oder weniger machtlos ist.