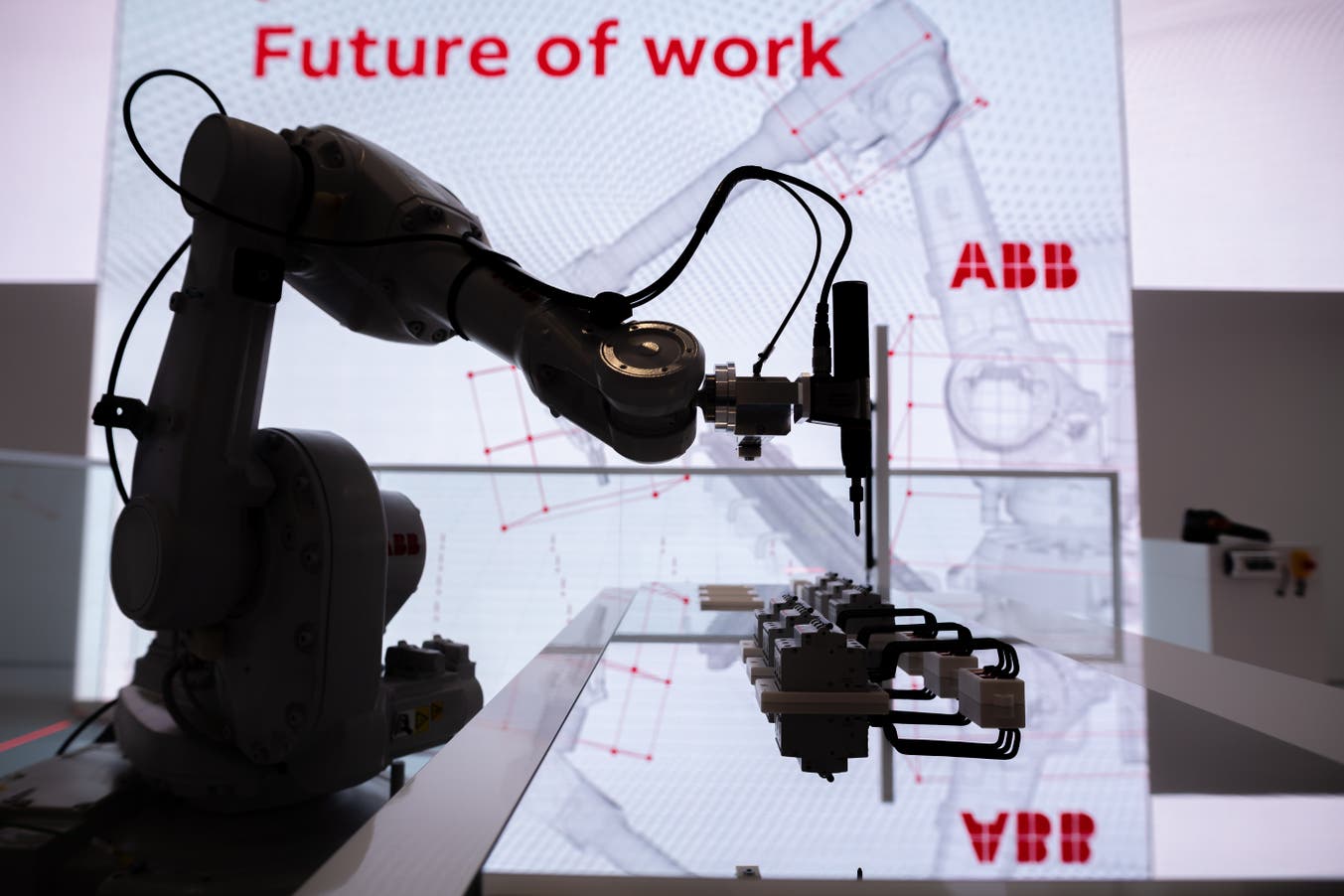Neuer Zweifel-CEO: «Ich bin ein bisschen konservativ, was Homeoffice anbelangt»
Im Juni 2020 wurde Christoph Zweifel Geschäftsführer der Zweifel Pomy Chips AG. Als 51-Jähriger und zur grossen Freude seines Vaters Hans-Heinrich, dem Mitgründer und ersten Geschäftsführer des Schweizer Chips-Giganten. Fünf Monate später stirbt der Vater und Corona hält die Schweiz in Atem.
Wenige Wochen nach dem Schicksalsschlag empfängt uns Christoph Zweifel am Hauptfabrikationsstandort der Firma in Spreitenbach. Im Neubau, fertiggestellt im Herbst 2019. Kosten: über 40 Millionen Franken. Wir gehen in die Genusswerkstatt, das Besucherzentrum, wo eigentlich bis zu 10000 Leute pro Jahr empfangen und unterhalten werden sollten. Wegen Corona ist keine Seele hier, der Raum dunkel, bevor wir mit dem Shooting und dem Interview beginnen.
Entschuldigen Sie den direkten Einstieg, aber es wirkt irgendwie schicksalhaft, dass Ihr Vater wenige Monate nach Ihrem Aufstieg zum CEO stirbt.
Christoph Zweifel: Das mag man so interpretieren. Er hat sich sehr gefreut, dass ich im letzten Jahr nach drei Monaten Bedenkfrist zugesagt habe, als Geschäftsführer zu übernehmen. Schon nach dem Studium wollte er mich ins Unternehmen holen, aber ich bin dann meinen eigenen Weg gegangen, bevor ich vor fünf Jahren operativ zum Unternehmen stiess und dann im Juni Geschäftsführer wurde. So hat es sich mein Vater immer gewünscht. Aber ich glaube nicht, dass sein Tod damit zusammenhängt, im Sinne, dass er erst so hätte gehen können.
Woran starb Ihr Vater denn, wenn man fragen darf?
Wir Zweifels haben ein Herzproblem, salopp formuliert. Mein Grossvater erlitt einen Herzstillstand, währenddem er am Telefon war und eine Bestellung entgegennahm. Mein Vater musste sich schon am Herz operieren lassen und hatte seine Probleme. Doch letztlich ist er friedlich eingeschlafen. Am Tag zuvor war ich noch mit meiner Mutter bei ihm im Spital. Er hat mit der Krankenschwester herumgeschäkert, gelacht, mich über das Geschäft gefragt. Genau so, wie wir ihn kannten.
Wie steht es um Ihr Herz?
Das habe ich natürlich schon untersuchen lassen. Alles ist in bester Ordnung. Ich bin topfit, spiele drei bis vier Mal pro Woche Badminton. Aber ich trage schon auch Sorge zu meiner Gesundheit und habe auf dem Radar, was in meiner Familie passiert ist.
Ihr Vater hat im Tessin ein Haus gekauft in den 70er-Jahren. Ein Rückzugsort für die Familie. Gibt es den noch?
Ja, natürlich. Meine Mutter war damals nicht begeistert von der Idee. Aber unterdessen haben wir uns alle ins Tessin verliebt. Es ist fast eine zweite Heimat geworden für uns, und das ist noch immer so. Es sind zwei, drei weitere Rustico dazu gekommen. In der Mitte gibt’s einen Treffpunkt. So können wir als Grossfamilie zusammenkommen.
Und Sie gehen immer noch hin?
Regelmässig. Am 1. August sind wir immer unten. Dann schlägt meine grosse Stunde.
Inwiefern?
Ich bin Pyromantiker, wie ich gerne sage (lacht). Andere würden mich einen leidenschaftlichen Feuerwerker nennen. Ich habe sogar Ausbildungen gemacht. An diesem Abend unterhalte ich die ganze Familie mit Feuerwerk und Musik, alles schön orchestriert (schmunzelt).
Wie hat Corona Ihr Geschäft tangiert?
Wir haben schnell Schutzmassnahmen für die Mitarbeitenden aufgezogen, den Krisenstab hochgefahren und reagiert. Aber dann kam es zu krassen Verschiebungen im Absatz. Das Retailgeschäft florierte. Die Verkäufe nahmen rund zehn Prozent zu, während der Gastronomiebereich, die Kioske und Selecta-Automaten einbüssten. Da verloren wir im Vergleich zum Vorjahr rund sieben Prozent. Es bleibt ein Plus von drei Prozent, das wir auf Corona zurückführen.
Welches Business ist für Zweifel lukrativer, Retail oder Gastronomie & Co.?
Wir nehmen das kleine Bergrestaurant genauso ernst wie den Volg oder die grossen Filialen von Coop, Migros oder Denner. Jedoch ist der Absatz dort am grössten, wo die Kundenfrequenz am höchsten ist.
Warum verweigern Sie sich denn noch immer den Discountern Aldi und Lidl?
Wir verweigern uns nicht, das stimmt so nicht. Wir sind in Verhandlungen und das schon länger.
Mit dem Resultat, dass es keine Zweifel-Chips gibt bei Aldi und Lidl.
Schauen Sie, wir haben diese Marke während mehr als 60 Jahren aufgebaut. Wir haben sie gehegt und gepflegt wie ein Baby und setzen weiterhin alles daran, um sie zu schützen. Uns gefällt die Markenpolitik der Harddiscounter aber nicht immer.
Bei Denner sind Sie im Angebot, obwohl auch das ein Discounter ist.
Denner hat unter Philippe Gaydoul einen Riesenschritt gemacht. Das Einkaufserlebnis hat unter ihm an Bedeutung gewonnen. Marken werden würdig präsentiert.
Daran hat die Krise nichts geändert. Wie hat sie das Unternehmen sonst verändert?
Natürlich hat es uns einen Digitalisierungsschub gegeben. Und ich muss zugeben, dass ich Lügen gestraft wurde.
Wie meinen Sie?
Ich bin ein bisschen konservativ, was Homeoffice anbelangt. Ich war der Meinung, dass die Leute nicht gleich effizient arbeiten. Aber unsere Teams haben extrem schnell umgestellt. Die Effizienz hat nicht gelitten, im Gegenteil. Das war ein Vorurteil.
Wird die Homeoffice-Möglichkeit also über die Krise hinaus bestehen bleiben?
Wir werden auf jeden Fall flexibler. Trotzdem brauchen wir auch die Nähe wieder, sobald das möglich ist. Unser Unternehmen lebt stark von Werten. Es geht da auch darum, gemeinsam Erfolge zu feiern. Wir haben auch ein Weinbusiness. Die Apérokultur hat auch bei uns im Unternehmen stark gelitten. Das kann man mit einem Videocall nicht kompensieren. Für internationale Meetings, wir sind auch Mitglied der European Snack Association, kann das aber schon eine Alternative sein. So können Reisen eingespart werden.
Krisen können auch Chancen sein. Haben Sie Absichten, stärker ins Ausland zu expandieren?
Im grenznahen Ausland, in Deutschland und Österreich sind wir ja schon vertreten. Da haben wir schöne Erfolge feiern können. Auch in Hongkong und Kuwait gibt es Zweifel-Chips.
In Kuwait? In der Wüste?
Das ist aus einer schönen Opportunität entstanden. Aber während wir hier Marktführer sind, sind wir dort einer unter vielen.
Wie kam es dazu?
Es ist eine persönliche Verbindung zur Besitzerin eines Detailhandelsgeschäfts aus Kuwait. Sie war immer wieder in der Schweiz. Sie hat uns an einer Messe kennen gelernt und war begeistert von unserer Qualität. Mittlerweile gibt es uns in Kuwait in einigen Dutzend Shops. Da sind wir natürlich im gehobeneren Preissegment, werden aber sehr schön präsentiert.
Das zeigt doch: Es ist mehr möglich im Ausland. Oder reizt Sie das nicht?
Mit dem richtigen Konzept und der richtigen Logistik kann es funktionieren. Dann gibt es da auch brachliegende Wachstumspotenziale und die möchten mein Team und ich natürlich realisieren.
Ökologisch nachhaltig ist das Kuwait-Geschäft ja nicht.
Dafür sind wir in unserem Hauptmarkt, der Schweiz, sehr nachhaltig. Wir haben vor zwei Jahren von Sonnenblumen- auf Rapsöl und von Meersalz auf Alpensalz umgestellt. Im langjährigen Durchschnitt kommen 95 Prozent aller Zutaten aus der Schweiz, im Idealfall sogar hundert.
Mussten Sie 2020 Kartoffeln aus dem Ausland zukaufen?
Wegen der gewachsenen Nachfrage mussten wir im Juni einige Tonnen importieren. Aber das Coronajahr war für die Kartoffeln ein gutes. Gut möglich, dass wir bis zur nächsten Ernte 2021 keine ausländischen Kartoffeln importieren müssen. Das versuchen wir, wann immer möglich, zu verhindern.
Ist es auch Ihrem Schweiz-Fokus zu verdanken, dass Sie beim Pestizid-Test von «K-Tipp» diesen Herbst als einziger keine Pestizidrückstände aufwiesen?
Sie haben die Chips auf Rückstände eines speziellen Keimhemmmittels getestet. Diese sind in der Schweiz sowieso ab nächstem Jahr verboten. Wir haben zusammen mit Fenaco, unserem Kartoffellieferanten, einen Weg gefunden, wie man auf das Mittel verzichten kann. Da steckt viel Forschung drin.
Setzen Sie wie andere Schweizer Lebensmittelproduzenten auf pestizidfreie Produktion?
Es wäre falsch Pestizide grundsätzlich zum Teufel zu wünschen. Was schon immer gebraucht wurde, kann kaum auf einmal giftig sein. Aber wir sind der Meinung, dass man so wenig wie nötig einsetzen soll. Die Rohstoffe sollen so naturbelassen wie möglich sein. Wir produzieren ja auch Biochips. Aber wer nicht bereit ist, einen Mehrpreis zu zahlen, bekommt halt nicht alles.
Und was tut sich an der Verpackungsfront?
Wir sind noch auf der Suche. Klar, man kann sagen, warum packt ihr die Chips nicht in Papier. Aber Papier ist sauerstoffdurchlässig, das verkürzt die Lagerfähigkeit und führt dazu, dass die Chips schneller ranzig sind. Sobald es etwas gibt, dass biologisch abbaubar ist und die Schutzqualität unserer heutigen Verpackung erfüllt, sind wir sofort dabei.
Zurück zum Inhalt. Welches ist eigentlich Ihre Lieblingssorte?
Kezz Paprika (ohne Zögern). Lange waren es die Original-Paprika-Chips, aber die Chips aus unserer neuen Kettle-Fritteuse finde ich noch besser. Etwas dicker und noch knuspriger. Kettle-Chips machen bei uns erst einen Anteil im einstelligen Prozent-Bereich der Verkäufe aus. In den USA sind es 15 Prozent. Da gibt es also Wachstumspotenzial.
Das orten Sie auch im Ausland. Man spürt, dass es Sie reizt. Welche anderen Visionen haben Sie eigentlich für das Unternehmen?
Wir stecken gerade mitten im Prozess, unsere neue Strategie für die kommenden Jahre zu definieren. Die Schweiz bleibt im Zentrum, hier müssen wir erfolgreich sein. Und wir wollen neuen Trends, zum Beispiel zu bewussterer Ernährung Rechnung tragen.
Mit Chips?
Da sind auch neue Konzepte gefordert. Wie zum Beispiel bei unseren Produkten der Marke «Vaya». Aus Bohnen, Kichererbsen und Süsskartoffeln. Davon brauchen wir mehr, in diesem Bereich möchte ich die Schlagzahl erhöhen. Da brauchen wir Innovationen.
Da könnte doch die nächste Zweifel-Generation behilflich sein. Die ist am Puls der Zeit.
Die fünfte Generation stösst nach. Neben meinen zwei Söhnen sind das zwölf weitere Nachkommen. Zwischen 10 und 28 Jahren alt. Wir als vierte Generation haben uns zum Ziel gesetzt, sie früher in die geschäftlichen Geschehnisse zu involvieren.
Warum?
Familienunternehmen haben viele Vorteile gegenüber Shareholder-Unternehmen. Aber es gibt auch die Gefahr, dass nicht alle am gleichen Strick ziehen. Das Geschäft leidet unter persönlichen Differenzen. Wir möchten deshalb unter unseren Nachkommen eine Kultur des Respekts und des Vertrauens aufbauen, in der man sich auch herausfordert.
Und wie machen Sie das?
Indem wir ein jährliches Treffen aller Generationen der ganzen Familie institutionalisieren. Es geht primär um den Austausch, darum, dass man miteinander reden kann. Wir informieren dabei die jüngste Generation auch über die groben Entwicklungen im Geschäftlichen. Das hatten wir mit 18 Jahren nicht.