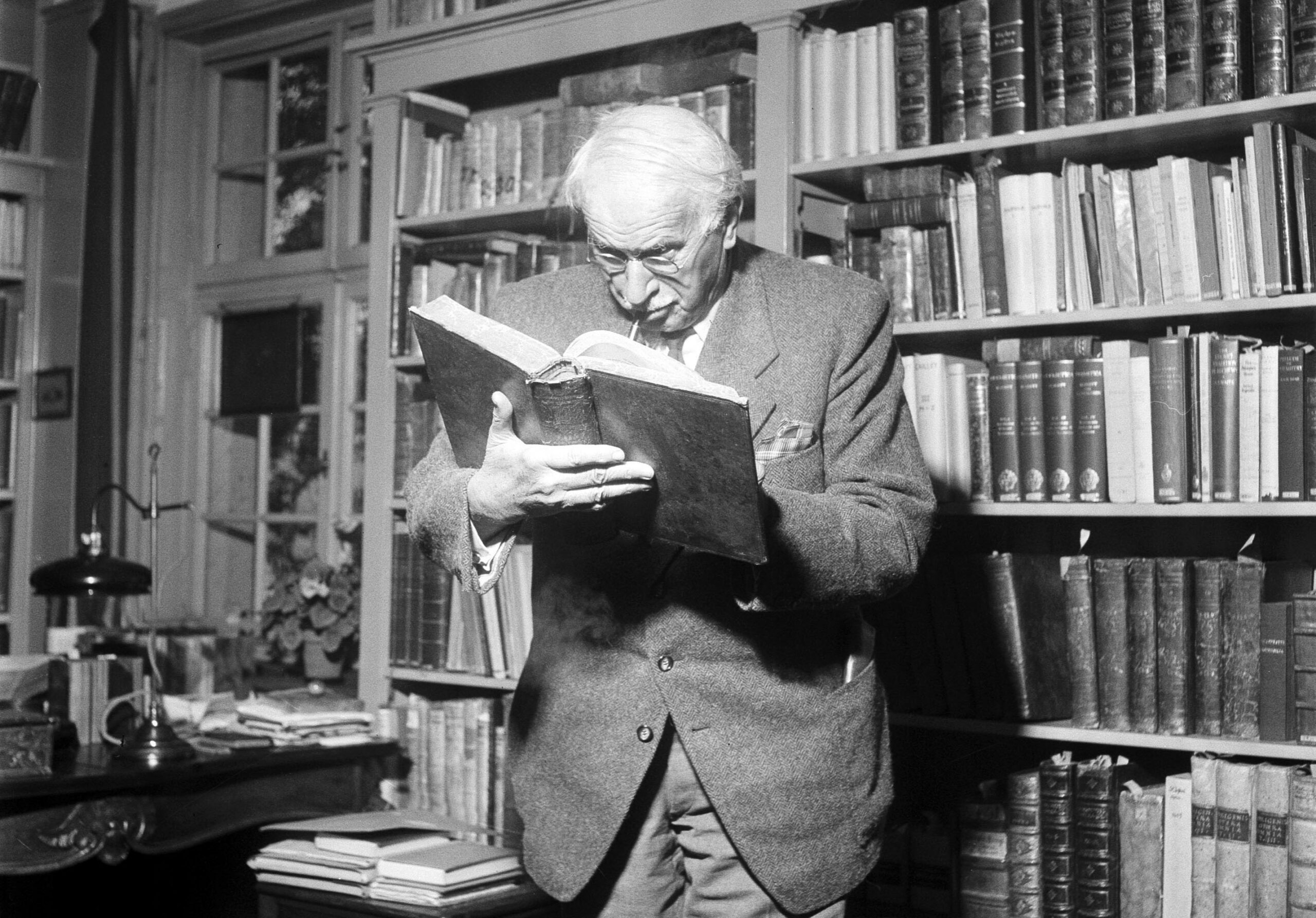Zofingia-Jubiläum (3/6): Vom Neuenburgerhandel zur Kuba-Krise


SERIE
Zofingen und Zofingia – die Stadt und die Studentenverbindung sind seit zwei Jahrhunderten aufs Engste verbunden. Im Sommer 1819 trafen sich in der Thutstadt 26 Zürcher und 34 Berner, um den Zofingerverein aus der Taufe zu heben. 200 Jahre später wird dieses Jubiläum mit einem dreitägigen Stadtfest vom 30. August bis 1. September ausführlich gefeiert. Gestern startete das Zofinger Tagblatt eine sechsteilige Serie zur Geschichte der Zofingia und ihrer Bundesstadt Zofingen. Wie kam es zur Gründung 1819? Was trieb die Mitglieder an, was haben sie geleistet – und wie haben sie die Schweizer Geschichte mitgestaltet? Und wo trifft man sie heute, wenn sie nicht gerade in Zofingen ihr Centralfest feiern? Autor ist der ehemalige NZZ-Journalist, Historiker und Publizist Dr. Ronald Roggen, der auch die Festschrift der Zofingia zum 200-Jahr-Jubiläum redigiert hat.
Teil 1: Zofingia 1819 – zur rechten Zeit, am idealen Ort, mit der schönsten Idee
Nach der geglückten Bundesgründung 1848 haben es viele Mitglieder der Zofingia ins Parlament geschafft, ihr Anteil stieg sogar noch weiter an. Die ersten Präsidien der beiden Räte waren von Zofingern besetzt. Im ersten Bundesrat sassen zwei ihrer Exponenten: Jonas Furrer als Bundespräsident, Ulrich Ochsenbein als weiteres Mitglied.
Wie Zofinger einen Krieg mit Preussen verhinderten
Über Jahrzehnte hatte Neuenburg unter preussischer Herrschaft gestanden und gleichzeitig dem eidgenössischen Staatenbund angehört. In der Regeneration lehnten sich demokratisch Gesinnte, darunter etliche Zofinger, gegen Preussen auf, was sie mit Kerkerhaft büssten. Einer der Zofinger starb sogar im Gefängnis.
Die Verfassung 1848 schrieb republikanische Kantonsverfassungen vor – da wurde es brenzlig. 1856 mobilisierte Preussen seine Armee. Die beiden eidgenössischen Räte, angeführt von den Zofingern Alfred Escher und Georges-François Briatte, zogen nach – es drohte Krieg. Die Schweiz sang das aufwühlende «Roulez Tambours!» des Zofingers Henri-Frédéric Amiel. Doch mit diplomatischen Mitteln konnten Zofinger den Krieg abwehren: In Paris der Thurgauer Johann Konrad Kern, ein Freund des Kaisers Napoleon III., in Berlin der Basler Zofinger Johann Heinrich Gelzer. Sie brachten es fertig, den Preussenkönig Friedrich Wilhelm IV. für den Neuenburgerhandel zu gewinnen, der Neuenburg aus der Herrschaft entliess – und die gefangenen Royalisten aus dem Gefängnis.
Während des Ersten Weltkriegs protestierten Waadtländer Zofinger gegen General Ulrich Willes Pro-Deutschlandkurs, indem sie beim deutschen Konsulat die deutsche Fahne herunterrissen. Ein Aufschrei bei der Polizei! Im Centralblatt wurden pazifistische Töne laut, worauf der General die Zofinger mit einem Verweis belegen wollte – was ihm misslang, weil der Bundesrat die Zofinger in Schutz nahm. Einmalig in den 200 Jahren der Zofingia: Sie hat damals an einer Bundesratssitzung ein eigenes Traktandum belegen können!
Im Landesstreik hatte der Zofinger Bundesrat Felix Calonder die harte Linie der Landesregierung zu vertreten, was in der heissen Phase des Streiks ein Blutvergiessen verhinderte. Friedlicher ging es im Bündnerland zu, wo der gleiche Calonder zusammen mit den Basler Zofingern Fritz und Paul Sarasin den Nationalpark initiierte. Calonder hat später im Auftrag des Völkerbunds in Oberschlesien für die Sicherheit der Minderheiten gesorgt, was einigen tausend Juden die Flucht ermöglichte. Für den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund hatten sich mehrere Zofinger starkgemacht.
Der grosse General und sein Freund: Guisan und Minger
Rudolf Minger, Chef des Militärdepartements, später Ehrenzofinger, förderte 1939 die Wahl Henri Guisans zum General – er war ebenfalls Mitglied der Zofingia. Die Wahl Guisans erwies sich als Glücksfall, die Freundschaft zwischen den beiden ebenfalls. Zusammen erschienen sie bei Kriegsende am Centralfest der Verbindung in der Bundesstadt Zofingen, mit dabei Bundespräsident Eduard von Steiger und Aussenminister Max Petitpierre. Ein Centralfest im Friedenstaumel.
Seit seiner Studienzeit war Guisan als Waadtländer und Freiburger Zofinger ein engagiertes Mitglied der Verbindung gewesen. Zwei Vorgänge, die sich im Zweiten Weltkrieg abspielten, illustrieren diese Nähe. Da gab es die Auseinandersetzung Guisans mit dem Korpskommandanten Alfred Miescher. Dieser befehligte das Armeekorps 3 und war in einer entscheidenden Frage anderer Meinung als Guisan. Zwei Zofinger in einer grossen Kontroverse: Guisan legte die Limmat als unverrückbare Verteidigungslinie fest, Miescher aber ordnete für seine Truppen zurückversetzte Stellungen an.
Interessant ist auch: Guisan, der bereits als Korpskommandant Kontakte mit französischen Generälen unterhielt, setzte für die Konkretisierung von Kooperationsplänen im Falle eines Südangriffs der Deutschen auf Mitglieder der Zofingia: Paul Logoz leitete die Arbeitsgruppe, Divisionär Edouard Petitpierre und Samuel Gonard waren ebenfalls dabei. Die Pläne wurden hinfällig, als die Deutschen 1940 Frankreich im Norden mit einem Blitzkrieg überzogen – und dabei die Pläne entdeckten.
Kapitulation der Japaner und US-Flüge über Kuba
Immer wieder haben Zofinger an geschichtsträchtigen Stellen bewiesen, dass sie bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Walter Stucki hat in Vichy gewirkt und die Stadt vor deutscher Bombardierung gerettet. 1945 war er eine Schlüsselfigur, als die USA mit den Japanern über die Kapitulation Verhandlungen führten, diese liefen über die Schweiz.
1962 war Botschafter August Lindt eine entscheidende Schaltstelle, als US-Präsident John F. Kennedy die russische Raketenbedrohung auf Kuba erkennen wollte. Lindt sorgte bei Fidel Castro dafür, dass die Aufklärungsflugzeuge nicht beschossen wurden. 1979 vermittelte Botschafter Erik Lang in Teheran, als dort radikale Anhänger Ajatollah Chomeinis die US-Botschaft besetzten und Geiseln nahmen.
Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Zofinger.
Seit der Gründung des Bundesstaates waren 21 Zofinger im Bundesrat
Ab 1848 gehörten 21 Zofinger dem Bundesrat an. Hier die Liste in offizieller Reihenfolge, mit Angabe des Kantons, der Amtsdauer und der Präsidialjahre (P):
1 Jonas Furrer (ZH) 1848–1861; P 1848, 1849, 1852, 1855, 1858
2 Ulrich Ochsenbein (BE) 1848–1854
9 Constant Fornerod (VD) 1855–1867; P 1857, 1863, 1867
14 Jean-Jacques Challet-Venel (GE) 1864–1872
16 Victor Ruffy (VD) 1867–1869
17 Paul Ceresole (VD) 1870–1875; P 1873
19 Eugène Borel (NE) 1872–1875.
20 Joachim Heer (GL) 1875–1878; P 1877
22 Bernhard Hammer (SO) 1875–1890; P 1879, 1889
27 Adolf Deucher (TG) 1883–1912; P 1886, 1897, 1903, 1909
35 Robert Comtesse (NE) 1900–1912; P 1904, 1910
37 Ludwig Forrer (ZH) 1902–1917; P 1906, 1912
44 Felix Louis Calonder (GR) 1913–1920; P 1918
45 Gustave Ador (GE) 1917–1919; P 1919
47 Karl Scheurer (BE) 1919–1929; P 1923
54 Johannes Baumann (AR) 1934–1940; P 1938
60 Eduard von Steiger (BE) 1940–1951; P 1945, 1951
63 Max Petitpierre (NE) 1944–1961; P 1950, 1955, 1960
80 Nello Celio (TI) 1966–1973; P 1972
87 Fritz Honegger (ZH) 1977–1982; P 1982
88 Pierre Aubert (NE) 1977–1987; P 1983, 1987