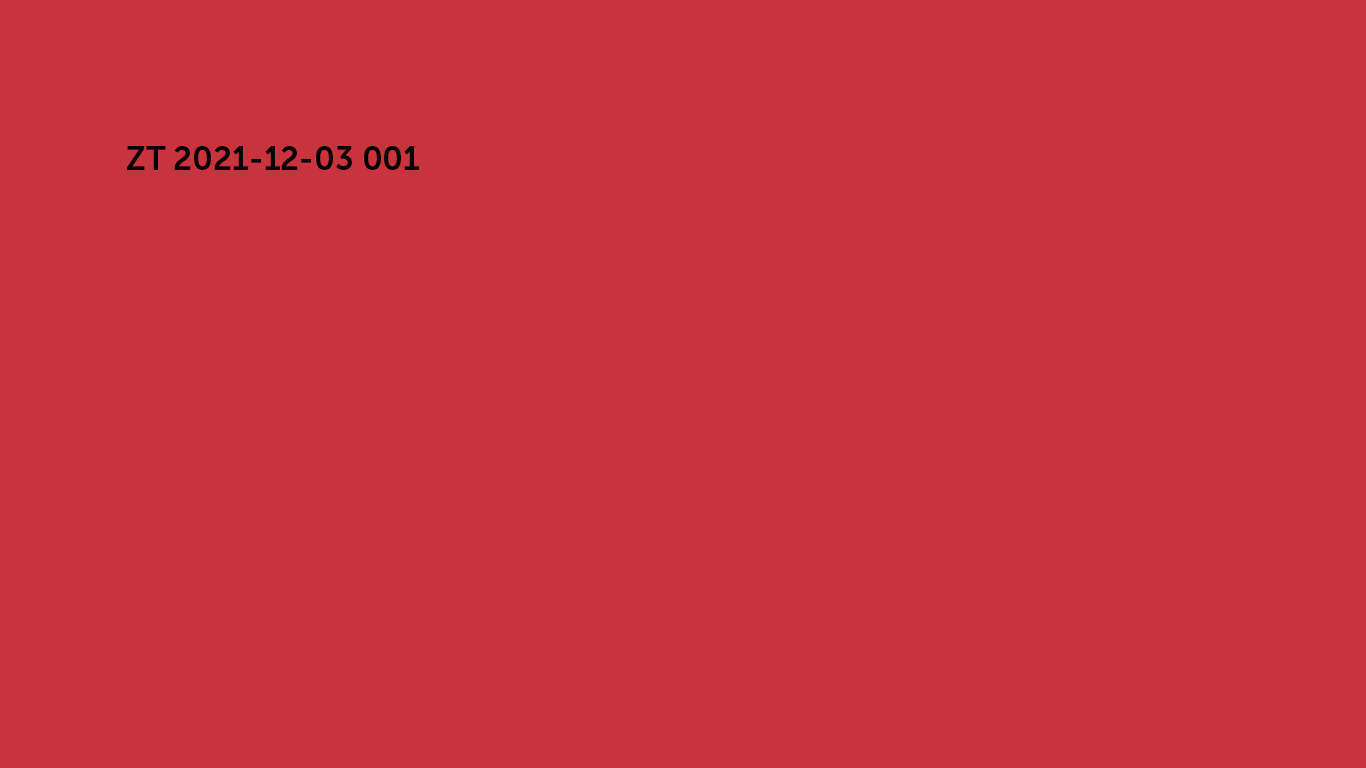310 ungelöste Cybercrime-Fälle beschäftigen die Luzerner Staatsnwaltschaft
Erstmals hat die Luzerner Staatsanwaltschaft für 2018 diejenigen Delikte extra statistisch ermittelt, die mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnologien begangen wurden. Sie kam auf 469 Fälle. 310 von diesen – rund zwei Drittel – wurden sistiert, weil die Täterschaft nicht ermittelt werden konnte. Dies sei unbefriedigend, sagte Oberstaatsanwalt Daniel Burri am Dienstag an der Jahresmedienkonferenz der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Burri ist überzeugt, dass mit der fortschreitenden Digitalisierung auch die Cyberkriminalität zunehmen werde. Die Entwicklung sei besorgniserregend, sagte er. Polizei und Staatsanwaltschaft müssten einen Schritt vorwärts machen, damit Luzern nicht von der Cyberkriminalität überrollt werde. Der Oberstaatsanwalt will zusammen mit der Kriminalpolizei ein entsprechendes Projekt starten und bis im Herbst dem Luzerner Regierungsrat den Bedarf aufzeigen. «Wir brauchen mehr Mittel und Möglichkeiten», sagte Burri. «Das kostet Geld.»
Burri schwebt vor, künftig spezialisierte Staatsanwälte auf die Cyberkriminellen anzusetzen. So können sich diese Personen an der Staatsanwaltschaftsakademie der Universität Luzern im Kurs «Cyberkriminalität» gezielt ausbilden lassen. Die personellen Ressourcen sollen verstärkt, die Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei ausgebaut werden. Handlungsbedarf sieht Burri aber auch bei der Infrastruktur. Die Spezialisten bräuchten Büros sowie die nötige Hard- und Software. Damit wäre die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern die erste in der Innerschweiz, die sich in Sachen Cyberkriminalität spezialisieren würde. In der Schweiz ist der Kanton Zürich Vorreiter.
Täter locken mit Anzahlungen
Burri erklärte, dass es auch in Zukunft Fälle geben werde, bei denen die Täterschaft nicht eruiert werden könne. Er erhofft sich aber auch eine präventive Wirkung, wenn sich herumspreche, dass die Luzerner Behörden bei der Cyberkriminalität aktiv seien. «Wenn wir nicht handeln, öffnen wir die Tore für diese Art von Kriminalität», ergänzte Simon Kopp, Leiter Medienstelle der Staatsanwaltschaft.
Bei rund 90 Prozent der unter die Cyberkriminalität fallenden Delikte geht es um Vermögensdelikte. Betrüger schreiben etwa im Internet Wohnungen oder Autos aus, die nicht existieren, und fordern von Interessenten Anzahlungen ein. Nur 3 Prozent der Cyberkriminalität entfällt auf Pornografie wie etwa dem Sexting.
Insgesamt verzeichnete die Luzerner Staatsanwaltschaft 2018 48 426 neue Fälle, dies gegenüber 51 916 im 2017. Grund für diesen Rückgang von sieben Prozent sind gemäss der Behörde Übertretungen im Massengeschäft. Die Zahl grosser und komplexer Fälle sei angestiegen. Darunter sind gemäss Burri Fälle zu verstehen, die nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können.
Nur ein kleiner Teil der Fälle, welcher die Staatsanwaltschaft behandelt, landet schliesslich vor einem Gericht. 2018 brachte die Staatsanwaltschaft 433 Fälle bei den Bezirksgerichten oder dem Kriminalgericht zur Anklage. Mehr als 37 000 Fälle wurden mit Strafbefehlen erledigt. Auch in der Jugendanwaltschaft war das Jahr 2018 gemäss Burri kein spektakuläres Jahr.
Guido Emmenegger, Leiter Zentrale Dienste der Staatsanwaltschaft, führte weiter aus und erklärte, dass in jedem fünften Fall die beschuldigte Person weiblich sei. Weiter beläuft sich der Anteil ausländischer Delinquenten auf 43 Prozent. Darunter fallen Kriminaltouristen, in der Schweiz wohnhafte Personen ausländischer Herkunft sowie im Ausland wohnhafte Personen, die sich beispielsweise ein Verkehrsdelikt zuschulden kommen liessen.
Folgenreiche Waffenimporte
Auch Strafbefehle können einschneidende Konsequenzen haben. Oberstaatsanwalt Burri erklärte, dass oft gerade Jugendliche ohne kriminelle Absichten via Internet im Ausland ein Schmetterlingsmesser, einen Elektroschocker oder eine andere Waffe bestellten, für deren Einfuhr eine Bewilligung vom Bundesamt für Polizei (fedpol) nötig sei. Der Zoll stellt diese Importe sicher und leitet den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter.
2018 gab es 58 solcher Fälle, im laufenden Jahr waren es bereits 30. Die Besteller erhalten statt der Waffe einen Strafbefehl. Die Folge: eine Geldstrafe, eine Busse und das Tragen der Untersuchungskosten. Dazu kommt ein Eintrag ins Strafregister. Gerade bei Jugendlichen könne ein solcher einschneidend sein, sagte Burri. Denn dieser erscheint bei einem persönlichen Auszug, der beispielsweise bei einer Bewerbung vorzulegen ist.
Aufgrund dessen weist die Staatsanwaltschaft präventiv auf die Konsequenzen hin und versucht die Bevölkerung hinsichtlich solcher Importe zu sensibilisieren. (sda/red)