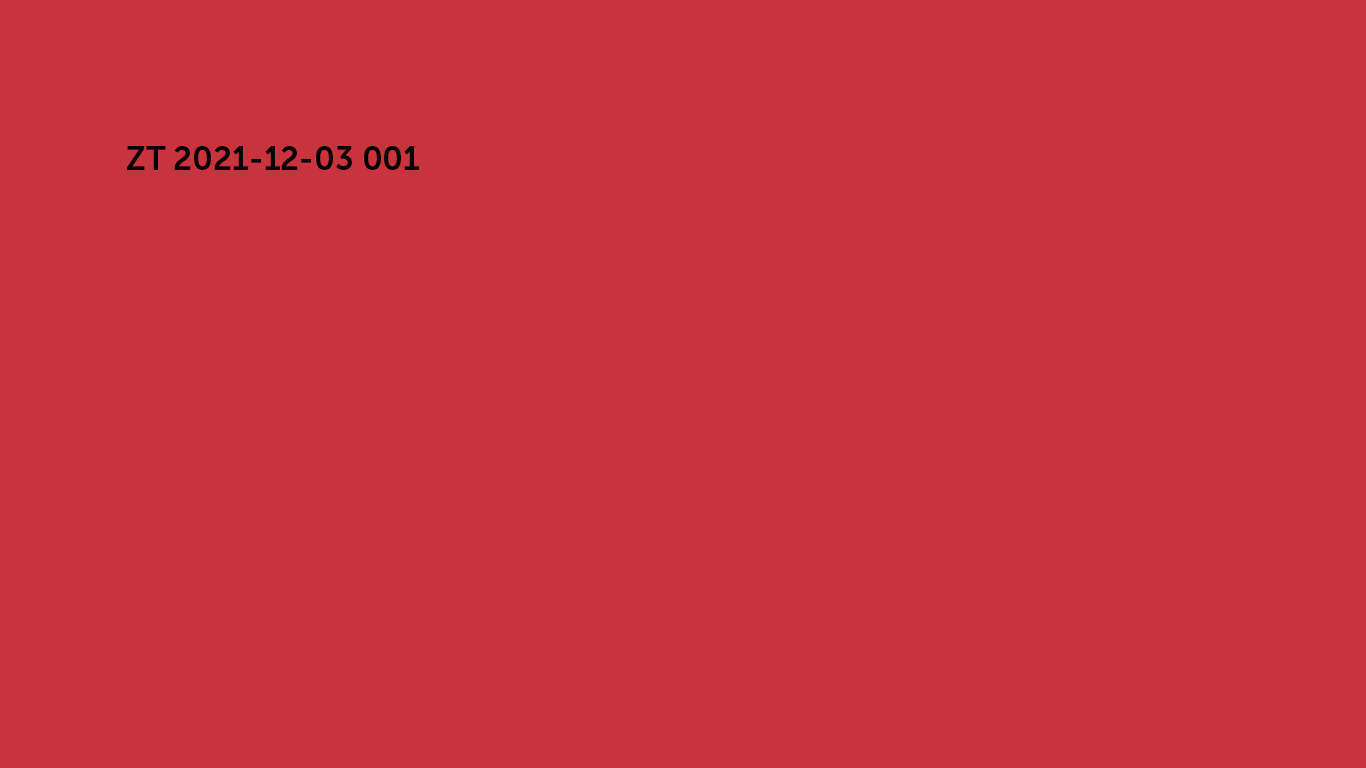Bauern und Land-Gemeinden wehren sich gegen Änderung des Feuerschutzgesetzes
Warum Wikon die Änderung gutheisst
Wikon ist eine Gemeinde mit viel Landwirtschaft, vor allem im Hintermoos. Der Luzerner Bauernverband ist gegen die neue Regelung. In der Vernehmlassung hat sich der Gemeinderat dennoch für eine Änderung des Gesetzes ausgesprochen. Warum? Wikons Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor sagt auf Anfrage: «Das geltende Feuerschutzgesetz ist recht alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.» Die Neuregelung der Beitragspflicht durch die Erweiterung des Perimeters auf 400 Meter und die Ausweitung der Beitragspflicht auf andere Wasserbezugsorte entspreche mehr dem Verursacherprinzip als die heutige Regelung. «Zudem können mehr Löscheinrichtungen realisiert und der Brandschutz somit verbessert werden», sagt Michaela Tschuor. Den Gemeinden gebe die vorgeschlagene Revision zudem Rechtssicherheit. Obschon Wikon eine ländliche Gemeinde ist, sei der Gemeinderat angehalten, alle Interessen und Argumente abzuwägen. «In diesem Fall überwiegen die Argumente der Rechtssicherheit und der verursachergerechten Finanzierung», erklärt die Gemeindepräsidentin. Da vom Kanton kein flächendeckendes Netz von Hydranten oder Löschwassereinrichtungen gefordert werde, befürchtet der Gemeinderat auch keine Kostensteigerung für die ländliche Region.
Im Kanton Luzern sollen Gebäudebesitzer sich finanziell stärker an Einrichtungen zur Brandbekämpfung beteiligen. Der Luzerner Regierungsrat beantragt dem Kantonsparlament deshalb eine Änderung des Feuerschutzgesetzes.
Um Brände in Zukunft mit mehr Löscheinrichtungen besser bekämpfen zu können, soll deren Finanzierung breiter abgestützt werden. Die Anpassung des Feuerschutzgesetzes stösst aber auf den Widerstand von ländlichen Gemeinden und den Bauern.
Die wichtigste Änderung besteht darin, dass der für die Beitragspflicht von Gebäudeeigentümern massgebliche Radius von 100 auf 400 Meter vergrössert werden soll. Zudem sollen neu nicht nur für Hydranten-Anlagen, sondern auch für andere Löscheinrichtungen Beiträge erhoben werden können.
Mehr Hauseigentümer in die Finanzierung einbinden
Begründet wird die Änderung damit, dass es in ländlichen Gebieten oft an geeigneten Löscheinrichtungen zur Brandbekämpfung fehle. Unter anderem deshalb, weil Hydrantenanlagen in entlegenen Siedlungen zu teuer oder technisch schwierig realisierbar seien. Zudem könnten momentan Eigentümer bei anderen Wasserbezugsorten wie beispielsweise Löschwasserbehältern, die in ländlichen Gebieten häufig besser geeignet seien, nicht in die Finanzierung eingebunden werden. Wenn es vor Ort an Löscheinrichtungen fehlt, müssten die Feuerwehren das Löschwasser über weite Strecken zur Brandstelle befördern. «Das ist zeitaufwendig und mit Leistungsverlusten verbunden. Auch die Zunahme von Trockenperioden erhöht das Brandrisiko und verschärft die Situation beim Löschwasser», heisst es in einer Mitteilung des Kantons weiter.
Gebäudeversicherung zahlt heute 35 Prozent
Für die Erstellung und Finanzierung von Löscheinrichtungen sind die Gemeinden verantwortlich. Die Gebäudeversicherung Luzern (GVL) beteiligt sich «massgeblich» an der Finanzierung. «Der Anteil der GVL an der Finanzierung beträgt momentan 35 Prozent der Investitionssumme», sagt Erwin Rast, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements. «Das soll sich auch in der Zukunft nicht ändern und ist im Reglement der GVL geregelt.» Hauseigentümer müssen heute nur Hydranten mitfinanzieren und dies auch nur dann, wenn diese maximal 100 Meter von ihrem Gebäude entfernt sind. «Mit diesen Rahmenbedingungen bekunden die Gemeinden zunehmend Mühe, genügend finanzielle Mittel für Löscheinrichtungen, insbesondere Löschwasserbehälter, bereitzustellen», sagt Rast.
Ausserdem könnten mit heutigen Schlauchverlege- und Tanklöschfahrzeugen als Druckerhöher auch Gebäude, die weiter als 100 Meter vom Wasserbezugsort entfernt sind, einigermassen wirkungsvoll mit Löschwasser geschützt werden. «Somit kommen auch Gebäudeeigentümer in einem weiteren Radius in den Genuss eines effizienten Feuerschutzes, ohne sich aber an der Finanzierung beteiligen zu müssen.»
Zur geplanten Änderung wurde eine Vernehmlassung durchgeführt. Bis auf die SVP begrüssen alle Kantonalparteien die Anpassung. Der Hauseigentümerverband Luzern, der Verband Casafair Zentralschweiz, der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) und die Gebäudeversicherung Luzern (GVL) unterstützen die Vorlage ebenfalls. Auch 40 der 58 Gemeinden, die Stellung genommen haben, befürworten die Revision; darunter Altishofen, Dagmersellen, Nebikon, Pfaffnau, Richenthal, Roggliswil und Wikon.
17 Gemeinden der Region Luzern West dagegen
Abgelehnt wird die Vorlage neben der SVP auch von der Arbeitsgruppe Berggebiet, vom Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband sowie insbesondere vom regionalen Entwicklungsträger Region Luzern West; diesem gehören 28 Verbandsgemeinden in den Regionen Willisau-Wiggertal, im Entlebuch und in Teilen des Rottals an. 17 der Luzern-West-Verbandsgemeinden fordern die Rückweisung und Überarbeitung der Vorlage; ausserhalb des Verbandsgebiets ist auch Altwis kritisch eingestellt.
Pius Hodel ist Gemeindeammann von Hergiswil bei Willisau und engagiert sich bei Luzern West. «Hergiswil hinterfragt das Vorhaben kritisch», sagt er auf Anfrage. «Wir arbeiten zwar gut mit der Gebäudeversicherung zusammen, haben aber in dieser Angelegenheit eine andere Ansicht.» Laut Hodel macht die Erweiterung des Perimeters von 100 auf 400 Meter keinen Sinn und nimmt zu wenig Rücksicht auf örtliche Verhältnisse. «In unserem sehr dünn besiedelten Gebiet erreicht man damit zu wenig Leute, weil die Höfe oft weit auseinanderliegen.» Im Perimeter von 100 Meter müsste ein Gebäude-Eigentümer deshalb allein an die Löscheinrichtung zahlen. Im Perimeter von 400 Metern seien es vielleicht fünf Bauern. «Doch mancher Landwirtschaftsbetrieb ist gar nicht direkt mit der Strasse erreichbar. Somit nützt auch die Verfügbarkeit des Wassers diesem gar nichts.»
In einem dichter besiedelten Gebiet könne man im Perimeter 400 Meter vielleicht 20 Höfe erreichen, die sich finanziell an den Löscheinrichtungen beteiligten. Somit wären die Kosten für jeden einzelnen niedriger. Das wiederum sei ungerecht gegenüber den Gebieten, wo aufgrund der dünnen Besiedlung nur wenige zahlten. «Es ist eine gewisse Ungerechtigkeit im System. Der Solidaritätsgedanke fehlt», sagt Pius Hodel. Laut dem Gemeindeammann ist ein Gebäude meist nicht mehr zu retten, wenn es einmal brennt. Davon, dass es nicht so weit komme und vor Ort Löscheinrichtungen vorhanden seien, profitiere vor allem die Gebäudeversicherung. «Ein Anliegen von Luzern West ist deshalb, dass sich die Gebäudeversicherung stärker an den Kosten beteiligt. Der Beitrag von aktuell 35 Prozent sollte erhöht werden.»
Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit sieht Hodel darin, dass der Kanton bei allen Gebäudeeigentümern, die noch nie Wasseranschlussgebühren bezahlt haben, einen Pauschalbeitrag einziehen könnte. «Mit den Beiträgen könnte ein Fonds geäufnet werden, aus dem die Einrichtungen finanziert werden könnten.» Ob dieses Finanzierungsmodell umsetzbar ist, müsste rechtlich noch geprüft werden, räumt er ein.
Nach der Vernehmlassung hat der Kanton das Gespräch mit dem Verband Region West gesucht. «In zwei Besprechungen konnte die Akzeptanz der Vorlage verbessert werden», hiess es in einer Mitteilung der Regierung. Es habe aufgezeigt werden können, «dass es keineswegs Ziel dieser Gesetzesänderung sei, ländliche Gebiete flächendeckend mit Löschwasserbehältern und Löschweihern auszustatten. Die teilweise bestehende Unterversorgung an solchen Einrichtungen solle aber punktuell mit sinnvollen Projekten behoben werden können.»
Höchstgrenze soll wegen Widerstand gesenkt werden
Einen Schritt ist die Kantonsregierung den Skeptikern bereits entgegengekommen: Die Ergebnisse der Vernehmlassung legten nahe, die Höchstgrenze des individuellen Beitrags von ursprünglich zwei auf ein Prozent des Gebäudeversicherungswerts zu senken.
Eine weitere Schlussfolgerung aus den Gesprächen mit der Region West sei, dass die vorgeschlagene Gesetzesänderung auch auf Projekte anwendbar sei, mit denen eine Vielzahl von Landwirtschaftsbetrieben mit Löschwasser versorgt werden soll. «Dieser sogenannte konzeptionelle Ansatz wurde durch die Region West ins Spiel gebracht und beispielsweise gemeindeübergreifend in Hergiswil bei Willisau und Luthern auch schon erfolgreich umgesetzt.»
Zum Widerstand der Landwirte sagt Stefan Heller, Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands auf Anfrage: «Wir haben uns stark mit dem Entwicklungsträger Luzern West abgestimmt, der Verband vertritt viele Landgemeinden im Westen des Kantons. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass die Gesetzesrevision nochmals überprüft werden sollte.» Heller plädiert dafür, dass man bei neuen Brandschutzeinrichtungen den Einzelfall anschaut und «nicht auf dem Reissbrett plant». Im Napfgebiet, im Luzerner Hinterland und im Entlebuch sei die klassische Streubausiedlung verbreitet. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass der Widerstand fruchtet und man nach den ersten Gesprächen auf gutem Weg sei. «Die Senkung der Höchstgrenze von zwei auf ein Prozent des Gebäudeversicherungswerts ist ein Erfolg. Dort wurde bereits etwas erreicht.» Die Botschaft des Regierungsrats zur Änderung des Gesetzes wird dieses Jahr im Kantonsparlament beraten werden.
Warum beispielsweise Wikon die Änderung gutheisst
Wikon ist eine Gemeinde mit viel Landwirtschaft, vor allem im Hintermoos. Der Luzerner Bauernverband ist gegen die neue Regelung. In der Vernehmlassung hat sich der Gemeinderat dennoch für eine Änderung des Gesetzes ausgesprochen. Warum? Wikons Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor sagt auf Anfrage: «Das geltende Feuerschutzgesetz ist recht alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.» Die Neuregelung der Beitragspflicht durch die Erweiterung des Perimeters auf 400 Meter und die Ausweitung der Beitragspflicht auf andere Wasserbezugsorte entspreche mehr dem Verursacherprinzip als die heutige Regelung. «Zudem können mehr Löscheinrichtungen realisiert und der Brandschutz somit verbessert werden», sagt Michaela Tschuor. Den Gemeinden gebe die vorgeschlagene Revision zudem Rechtssicherheit. Obschon Wikon eine ländliche Gemeinde ist, sei der Gemeinderat angehalten, alle Interessen und Argumente abzuwägen. «In diesem Fall überwiegen die Argumente der Rechtssicherheit und der verursachergerechten Finanzierung», erklärt die Gemeindepräsidentin. Da vom Kanton kein flächendeckendes Netz von Hydranten oder Löschwassereinrichtungen gefordert werde, befürchtet der Gemeinderat auch keine Kostensteigerung für die ländliche Region. (ben)
Was kosten Hydranten und Löschinfrastruktur?
Ein Löschwasserbehälter kostet laut Angaben des Luzerner Justiz- und Sicherheitsdepartements rund 80 000 Franken. Heute würden eher Löschwasserbehälter als Löschweiher gebaut. Der Preis eines einzelnen Hydranten beträgt rund 8000 Franken inklusive des erforderlichen Leitungsstücks und des Schiebers. «Ein einzelner Hydrant funktioniert aber erst im Verbund mit einer Hydrantenanlage», erklärt Sprecher Erwin Rast. Diese beinhaltet: Reservoire, Leitungen, und Steuerungen. «Bei Hydrantenanlagen sprechen wir schnell von Kosten von mehreren hunderttausend Franken», sagt Rast. Die Kosten für die Anlage trügen jedoch die Gemeinden und Gebäudeversicherung – und nicht die Liegenschaftenbesitzer.