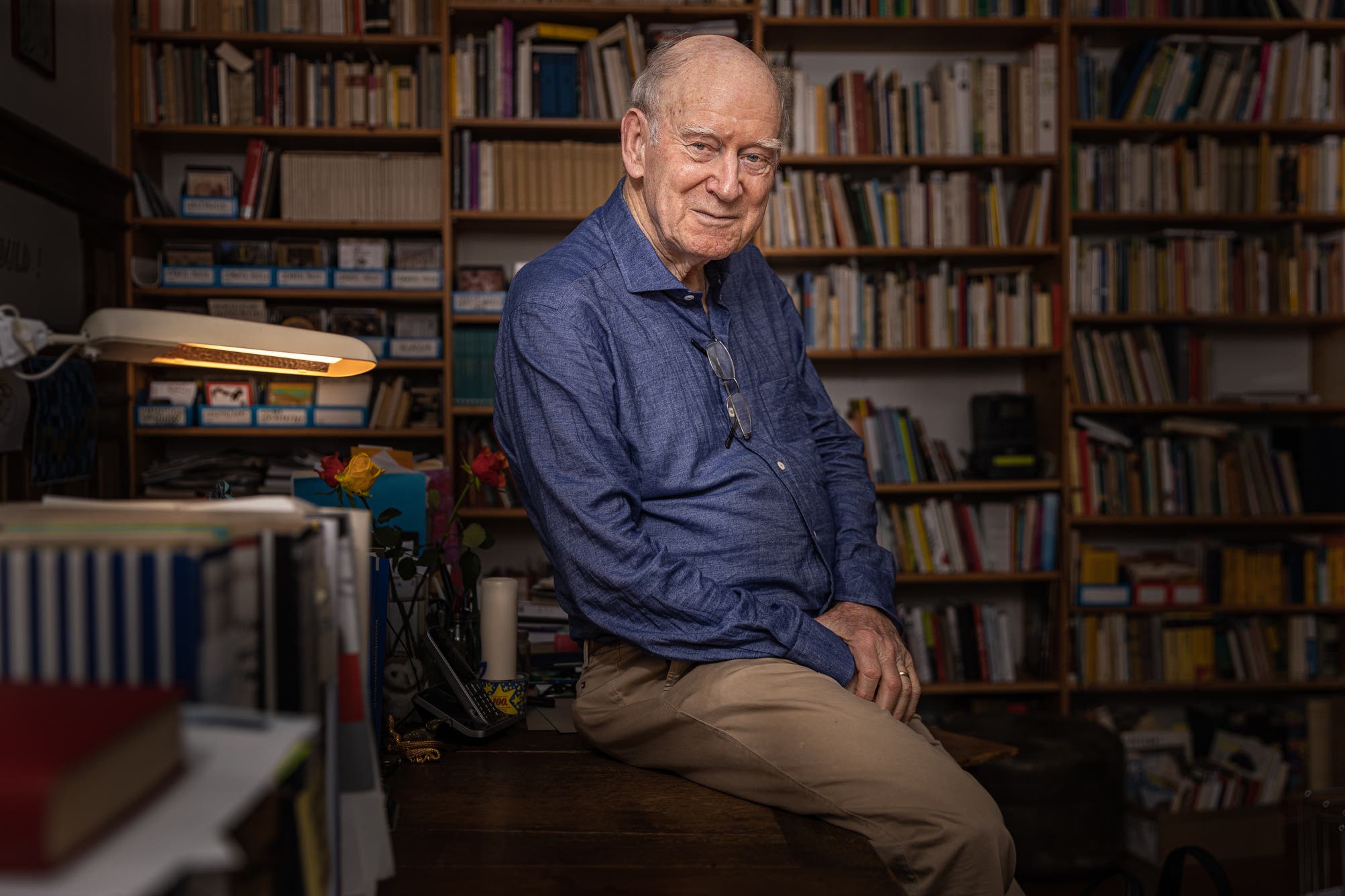«Ich habe die Geduld nicht mehr» – warum sich alt Bundesrätin Ruth Metzler für die Individualbesteuerung einsetzt
Manche ehemaligen Bundesräte äussern sich mehrmals jährlich in Interviews. Sie machen das nur selten. Weshalb?
Ruth Metzler: Ich äussere mich zu Themen, zu denen ich einen sachlichen Bezug habe, etwa als Präsidentin von Switzerland Global Enterprise oder der Stiftung der Schweizergarde. Ich will nicht als Person im Mittelpunkt stehen und dem amtierenden Bundesrat besserwisserisch Ratschläge geben.
Jetzt engagieren Sie sich aktiv für die Initiative der FDP Frauen für eine Individualbesteuerung. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich habe eine lange Geschichte mit der Familienbesteuerung. Als Regierungsrätin war ich vor 23 Jahren Mitglied einer Expertenkommission zum Thema. Wir vertieften drei Modelle, darunter. die Individualbesteuerung. Ich bin immer für eine Änderung des heutigen Systems eingestanden, weil es Doppelverdiener-Ehepaare stark benachteiligt. Viele Kantone haben die steuerliche Heiratsstrafe zwar beseitigt, aber der Bund hat hier seine Hausaufgaben nicht gemacht. Als die CVP-Initiative zur Heiratsstrafe abgelehnt wurde, war ich verärgert. Und noch mehr verärgert war ich, als auskam, dass der Bund im Abstimmungskampf falsche Zahlen verwendet hatte.
Haben Sie Ihre Meinung zur Individualbesteuerung geändert?
Nein. Ich war schon früher nicht dagegen, aber es war für mich nicht die einzige mögliche Lösung. Wäre die CVP-Initiative angenommen worden, hätte ich das auch gut gefunden. Aber die Individualbesteuerung enthält Elemente, die im Sinne der Gleichstellung einen Schritt weiter gehen. Sie ist die fairste Lösung.
Das will die Initiative
Die FDP Frauen Schweiz haben am internationalen «Tag der Frau» offiziell ihre Volksinitiative zur Einführung der zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung lanciert. Diese sieht vor, dass Personen künftig ungeachtet ihres Zivilstandes besteuert werden. Ob jemand alleinstehend, liiert, verheiratet, getrennt oder geschieden ist, soll laut dem Initiativtext keine Rolle mehr spielen. Künftig soll nur noch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei der Besteuerung ausschlaggebend sein. Auf die politische Agenda war das Thema der Besteuerung von Paaren schon sehr viel früher gelangt. Eine verwandte Initiative der CVP von 2016 etwa hatte beabsichtigt, die «Heiratsstrafe» abzuschaffen, ist aber am Volksmehr gescheitert. Wegen eines Fehlers in den Abstimmungsunterlagen wurde die verlorene Abstimmung annulliert, weswegen die damalige CVP und heutige Die Mitte Anfang 2020 bekanntgab, einen zweiten Anlauf zu unternehmen. (frh)
Die CVP kämpfte lange unter dem Schlagwort Familienpartei gegen die Heiratsstrafe. Jetzt unterstützt ihre alt Bundesrätin und weitere prominente Frauen aus der Partei mit der Individualbesteuerung für einen Umsturz des Steuersystems.
Die Individualbesteuerung ist kein Umsturz. Im Ausland ist sie teilweise schon jahrzehntelang Praxis. Und auch bei uns wird jeder, der nicht – oder noch nicht – verheiratet ist, individuell besteuert. Dieses Modell ändert sich erst mit der Heirat. Individualbesteuerung bedeutet, dass anders als das heute der Fall ist, nicht mehr das Lebensmodell «Verheiratet und Alleinverdiener» eine bevorzugte Stellung hat:
Meine Unterstützung für die Initiative richtet sich nicht gegen meine Partei. Ich habe übrigens aus Parteikreisen viele positive Reaktionen erhalten auf mein Engagement – vor allem von Frauen unterschiedlichsten Generationen.
Geht es Ihnen vor allem um die Gleichstellung?
Unbedingt! Es geht mir auch ein wenig darum, dass Frauen heute zum Anhängsel ihres Ehemannes werden, wenn die Steuererklärung ins Haus flattert. Das ist aber nur ein Nebenaspekt. Für verheiratete Zweitverdiener – meist sind es Frauen – lohnt es sich heute wegen der Steuern teilweise kaum, erwerbstätig zu sein oder das Pensum zu erhöhen.
Natürlich ist die Steuerbelastung dabei nur ein Element. Zentral ist auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Tagesschulen zum Beispiel sollten selbstverständlich sein.
Wer steht in der Pflicht vorwärts zu machen – Politik oder Wirtschaft?
Vereinbarkeit ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da müssen Politik und Wirtschaft daran arbeiten.
Umso mehr freut mich der Entscheid des Bundesrates vom letzten Freitag, zusätzliche 80 Mio. für Kitas und weitere Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen.
Neben den Steuern tragen auch die Kita-Kosten dazu bei, dass es sich für viele Paare nicht rechnet, mit zwei hohen Pensen zu arbeiten. Braucht es mehr staatliche Finanzierung für Kinderbetreuung?
Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass alles für alle gratis sein sollte. Jene, die es vermögen, sollen ihren Beitrag zahlen. Der Staat soll diese Kosten nicht für alle tragen.
Wie steht es abgesehen von steuerlichen Fragen um die Gleichstellung in der Schweiz?
Rechtlich stehen wir heute gut da. Was oft vergessen wird: Das neue Eherecht war ein grosser Schritt. Wenn man bedenkt, dass Christoph Blocher noch 1985 das Referendumskomitee anführte, weil das neue Eherecht die Bedürfnisse der Familie übergehe zugunsten der individuellen Bedürfnisse der Eheleute – unvorstellbar! Ein offenes Thema sind die Lohnunterschiede, wobei die Statistiken für mich nicht in allen Punkten nachvollziehbar sind. Etwas anderes, was nicht zugunsten der Frauen ist: Die Angleichung des AHV-Alters ist ein längst fälliger Schritt.
Sind Sie bei einzelnen Aspekten der Gleichstellung überrascht, dass es nicht schneller vorwärts geht?
Negativ überrascht mich, dass aktuell sechs Kantonsregierungen nur aus Männern bestehen. Das darf nicht sein. In den 1990er Jahren entstand ein Schub, unter anderem auch rund um meine Wahl. Der ist wieder abgeflacht. Auch in der Wirtschaft geht es zu langsam vorwärts. Gerade in Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, erwarte ich, dass das auch in den Führungsfunktionen abgebildet ist. Davon sind wir noch weit entfernt.
Sie galten als Vertreterin des wirtschaftsfreundlichen CVP-Flügels. Nun sind Sie für eine Frauenquote für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen. Das ist nicht besonders liberal.
Liberal ist es vielleicht nicht, aber auch nicht wirtschaftsfeindlich! Wenn man davon ausgeht, dass gemischte Teams die besten Resultate bringen, dann ist es unverständlich, dass man nicht mehr für die Vielfalt tut. In der Schweiz kennen wir Quoten zudem schon lange, etwa für sprachliche Minderheiten. Ich war lange der Ansicht, es müsse ohne Quote funktionieren:
Aber es geht seit Jahren nur sehr langsam vorwärts. Ich habe die Geduld nicht mehr.
Sie sitzen als einzige Frau im neunköpfigen Verwaltungsrat von Swiss Medical Network SA. Stört Sie das?
Ja, die Herren wissen das auch (lacht). Aber: In den beiden Tochtergesellschaften sind mehrere Frauen im Verwaltungsrat.
Werfen wir einen Blick zurück: Als Sie 1991 nach Appenzell-Innerrhoden zogen, durften die Frauen an der Landsgemeinde erstmals mitstimmen. Fünf Jahre später wurden sie von der Landsgemeinde als erste Frau in die Regierung gewählt. Wie erlebten Sie diese Pionierrolle?
Die Wahl war ausserhalb des Kantons eine grössere Sensation als in Innerrhoden. Die Landsgemeinde hatte mich zuvor ja schon als Kantonsrichterin gewählt. Was ich als Regierungsrätin und später als Bundesrätin feststellte:
Tat man das nicht, hiess es: Die politisiert wie ein Mann. Als bürgerliche Frau erlebte ich viele Angriffe deswegen, gerade in der Asylpolitik. In den Regierungsgremien selbst änderte sich das Verhalten und die Sprache, als Frauen dazukamen – zumindest wurde mir das gesagt.
Also keine Altherrenwitze mehr?
Genau. Da musste ich zu Beginn noch ab und zu eingreifen und sagen: Es sitzt übrigens auch eine Frau hier (lacht).
1999 wurden Sie in den Bundesrat gewählt – als dritte Frau und erste CVP-Vertreterin. Wie haben Sie das Eingewöhnen in den Bundesrat erlebt?
Im Gremium selbst verlief das problemlos. Mit SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss und mir sassen erstmals zwei Frauen in der Regierung. Wir verstanden uns gut, aber waren in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Dadurch konnten wir viele Frauen vertreten. Eine Bundesrätin alleine kann nicht alle Frauen repräsentieren. Auch viele Jüngere fühlten sich durch mich erstmals vertreten; es herrschte Aufbruchsstimmung. In meinem Departement wurde darüber geredet, dass gestandene Herren eine so junge Frau als Chefin bekamen. Das war damals sehr aussergewöhnlich. Aber ich empfand das nie als Problem.
Haben Sie das unterschwellig gespürt?
Nein. Aber über Umwege erfuhr ich von Bemerkungen wie: «Sie könnte ja meine Tochter sein».
Es heisst oft, Frauen müssten besser vorbereitet sein und Dossiers besser im Griff haben, um ernst genommen zu werden. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ich hatte als Bundesrätin auch das Gefühl, ich müsste die Dossiers sehr gut kennen. Das hatte aber weniger mit meinem Geschlecht zu tun, sondern mit meinem Alter.
Wie erlebten Sie Ihre Abwahl 2003? Es war – einmal mehr – ein Drama um eine Bundesrätin.
Meine Abwahl hatte meines Erachtens nichts mit meinem Frausein zu tun, sondern mit der politischen Konstellation. Die SVP hatte damals erneut zugelegt und einen zweiten Bundesratssitz gefordert. Schmerzhaft war vor allem, was vor der Wahl gelaufen ist, auch innerhalb meiner Fraktion. Ich weiss noch haargenau, wer mich brandschwarz angelogen hat – und wer mir nachher jahrelang aus dem Weg ging.
Gestört hat mich auch, dass linke Frauen, die mich nicht gewählt hatten, nachher aufschrien, weil nur noch eine Frau im Bundesrat war. Aber ich habe das abgehakt. Wenn ich etwas nicht ändern kann, hadere ich nicht damit. Ich setze meine Energie und Kraft ein für die Zukunft, wo ich etwas bewirken kann.
Wie haben Sie den Frauenstreik 2019 und die darauffolgende «Frauenwahl» erlebt?
Den Frauenstreik erlebte ich aus der Ferne. Ich habe noch nie gestreikt. Ich glaube, ich kann meinen Beitrag anders leisten. Wenn Frauen in politische Ämter gewählt werden, freut mich das – ebenso, wenn sie in der Wirtschaft ihren Weg machen. Wir sind uns in der Politik und der Wirtschaft durchschnittliche Männer gewöhnt. Bei den Frauen aber besteht immer noch der Anspruch, alle müssten überdurchschnittlich sein.
Weshalb?
Aus Vorsicht will man keine Fehler machen. Mein persönlicher Eindruck ist: Wenn eine Frau scheitert, ist das sichtbarer, als wenn ein Mann scheitert.
Ein anderes Thema: Die CVP heisst neu Die Mitte. Ein richtiger Schritt?
Ich hoffe es. Ich war nicht dagegen, und ich war nicht Feuer und Flamme dafür. Ich vertraue der Führungsriege der CVP – sie hat das gut abgeklärt und breit diskutiert.
In Appenzell-Innerrhoden heisst die Partei noch CVP. Sind Sie froh darüber?
(lacht). Ich war so lange CVP-Mitglied, da braucht es Zeit, sich umzugewöhnen – wie wenn man heiratet und den Namen des Partners annimmt. Momentan muss ich als Mitglied der Innerrhoder CVP den Zungenbrecher Die Mitte noch nicht aussprechen (lacht).
Als Präsidentin von Switzerland Global Enterprise sind Sie nah an der von der Pandemie stark betroffenen Exportwirtschaft. Wie sehen deren Perspektiven aus?
Die Situation ist generell sehr schwierig. Bei den KMU ist aber ein gewisser Optimismus da; die Anfragen, die wir erhalten, stimmen mich aktuell verhalten positiv. Das darf aber nicht darüber wegtäuschen, dass viele leiden. Gerade in der für die Schweiz sehr wichtigen Exportbranche der Maschinen-, Energie- und Metallindustrie. Letztlich bestimmt die Pandemie, wie sich die Lage entwickelt. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass Reisen möglich ist; so dass zum Beispiel ein Monteur vor Ort installieren kann, ohne nachher lange in Quarantäne zu müssen.
Was halten Sie vom Kurs des Bundesrats bei Corona?
Bei solchen Entscheiden kann man oft nicht zwischen zwei guten Optionen wählen, sondern zwischen zwei relativ schlechten . Im Grossen und Ganzen kann ich die Massnahmen nachvollziehen. Schwierig finde ich, dass im Kleinen nicht nachvollziehbare Entscheide gefällt wurden. Wenn man in Detailfragen an Glaubwürdigkeit einbüsst, schlägt das zurück aufs Ganze. Und die Kommunikation scheint mir beim zweiten Lockdown schlechter. Man muss erklären, warum welche Entscheide getroffen werden – und warum gerade jetzt und nicht später. Das hat mir ab und zu gefehlt.
Können Sie ein Beispiel für eine Detailfrage nennen?
Das Chaos um die Bäckereien im Dezember zum Beispiel, als unklar war, ob sie am Sonntag öffnen dürfen. So etwas darf nicht sein.
Der Ton ist derzeit rau. Die SVP bezeichnet Alain Berset als Diktator. Wie wirken sich solche Vorwürfe auf die politische Kultur aus?
Das ist SVP-Rhetorik. Angesichts der politischen Schlagwörter der letzten 20 Jahre ist es nicht überraschend. Dieser Tonfall, diese Wortwahl missfallen mir. Aber jene SVP-Politiker, die sie verwenden, ticken halt so – und verharmlosen dabei echte Diktaturen.
Ein anderes grosses Thema: Sie haben sich vor zwei Jahren öffentlich für das Rahmenabkommen ausgesprochen. Wie stehen Sie heute dazu?
Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich freue mich, dass sich die Gruppe Progresuisse formiert hat, in der auch Doris Leuthard mitmacht. Ich hoffe, dass man einen Weg findet, die offenen Fragen zu klären – und zwar so, dass Bundesrat, Parlament und Volk Ja sagen können dazu.
Sie sind zuversichtlich, dass das noch möglich ist?
Staatssekretärin Livia Leu wird das Mögliche herausholen, davon bin ich überzeugt. Ob es das ist, was wir wollen, ist eine andere Frage.