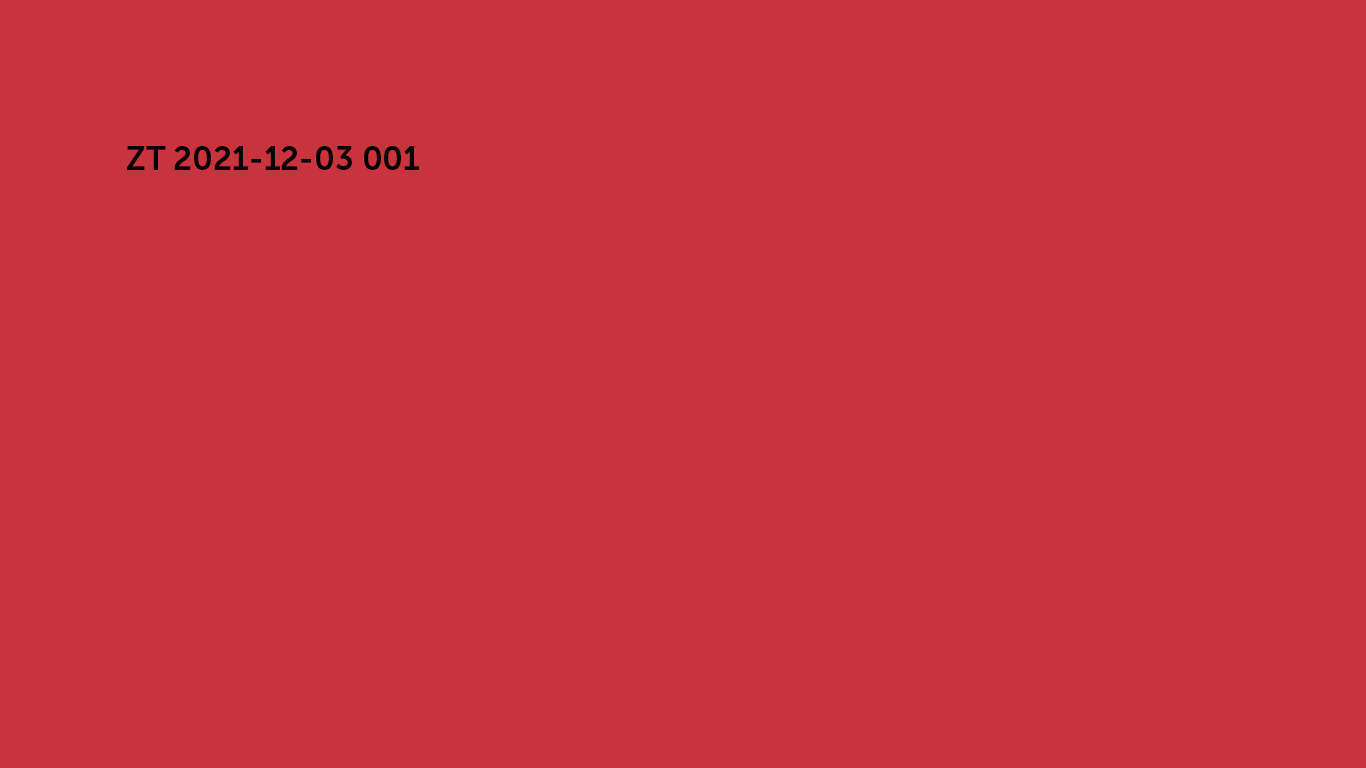Klimaschutz: Der Wald steht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit

Wetterextreme machen den Bäumen zu schaffen. Als Folge von Stürmen, Trockenheits- und Borkenkäferschäden entstehen übermässig viele Jungwaldflächen. «Auf diesen werden die Weichen für die Zukunft gestellt», hiess es an einer Medienorientierung des Kantons Luzern diese Woche.
Am Rundgang im Chüewald in Beromünster zeigten Regierungsrat Fabian Peter (FDP), Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, Mitarbeitende der Dienststelle Landwirtschaft und Wald sowie Vertreter der Korporation Beromünster auf, warum der Wald und das Holz für den Klimaschutz wichtig sind.
Der Klimawandel hat auf den Wald starke Auswirkungen: Die Durchschnittstemperaturen steigen, die Sommer werden trockener, und es gibt mehr Hitzetage und Starkniederschläge. Die Baumartenzusammensetzung sei stark von diesen Faktoren geprägt und werde sich entsprechend verändern.
Die Fachleute erwarten vermehrt Schäden
Weiter erwarten die Fachleute, dass sich die Verbreitung und Vermehrungsrate von vorhandenen und neuen Waldschädlingen und -nützlingen verändert. Es entstehen vermehrt Schäden durch Spätfröste und Nassschnee, Hangrutsche im Wald nehmen zu, und die Waldbrandgefahr steigt.
Die Holznutzung wird hauptsächlich durch Waldschäden getrieben. Die Holzpreise sind dadurch stark unter Druck geraten und die Flächen für die Wiederbewaldung haben um rund die Hälfte zugenommen.
Zusammen mit den betrieblichen Waldorganisationen verfolgt der Kanton Luzern das Ziel, die verschiedenen Leistungen des Waldes wie die Holzproduktion, den Schutz vor Naturgefahren, den Lebensraum für Pflanzen und Tiere, den Erholungsraum sowie den Wasser- und CO2-Speicher langfristig zu sichern und die Risiken zu minimieren.
Eine regelmässige Waldpflege und Holznutzung sowie die Förderung der Biodiversität seien dabei wichtig. Dies, um die Waldbestände gegen Störungen widerstandsfähig, erneuerungsfähig und anpassungsfähig zu gestalten. Der Schlüssel liege darin, die Vielfalt der Baumarten, Waldstrukturen und Genetik zu erhöhen.
Während der Holzerlös eine nachhaltige Nutzung dieses regionalen Rohstoffs finanzieren soll, seien weitergehende Anforderungen der Gesellschaft durch die Nutzniessenden und die öffentliche Hand abzugelten, hiess es an der Orientierung.
So sollten zusätzliche Massnahmen im Erholungsbereich wie Freizeitwege in erster Linie durch die Nutzergruppen finanziert werden. Dagegen unterstützt der Kanton Luzern zusammen mit dem Bund insbesondere die Schutzwaldpflege, aber auch Massnahmen zur Förderung der Biodiversität, die Wiederbewaldung der Schadenflächen und die Jungwaldpflege.
Aufgestockt: Schon über eine Million Franken von Kanton und Bund
Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa), sagte dazu: «Der Kanton Luzern und der Bund unterstützen die Wiederbewaldung und Jungwaldpflege mit zusammen jährlich 0,8 Millionen Franken.» Die Aufteilung sei hälftig Kanton und Bund. Aufgrund von Folgemassnahmen stiegen die Aufwendungen auf über eine Million Franken. «Das ist gegenüber der Periode vor 2018 rund doppelt so viel», betont Röösli.
Der Klimawandel führt dazu, dass mehr und grössere Schadenflächen entstehen. Ergänzende Pflanzungen von Eichen, Linden, Föhren oder anderen klimaangepassten Baumarten seien um ein Vielfaches teurer als die natürliche Waldverjüngung, hiess es. Der Kanton Luzern stellt deshalb, gestützt auf parlamentarische Vorstösse auf Bundes- und Kantonsstufe, zusätzliche Mittel für die Budgetplanung ein. Er prüft zudem ergänzend Sicherheitsholzschläge entlang von öffentlichen Infrastrukturen wie Strasse und Schiene.
Die vermehrte Verwendung von regionalem Holz – als Baumaterial und zum Heizen – ermögliche ausserdem auf verschiedene Weise, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Planungsbericht Klima und Energie des Kantons sind Massnahmen im Bereich Wald und Holz vorgesehen, die einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. (pd/ben)