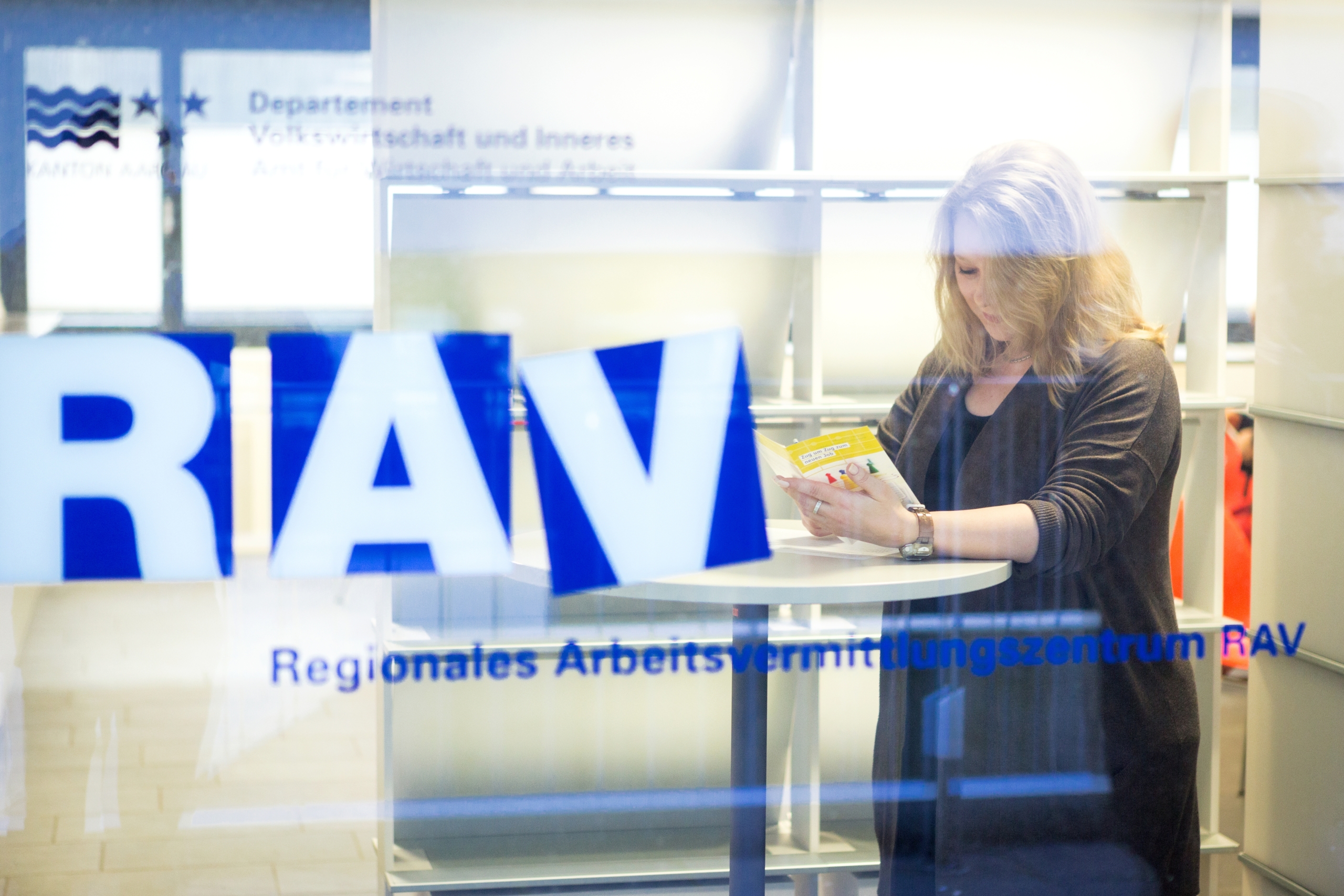«Tiefhaus» statt Hochhaus? Ja, das geht
Wem gehört der Untergrund – das, was sich unter dem Grundstück befindet? Wer darf hier was bauen? Der Ansturm auf das Erdreich ist mittlerweile gross – insbesondere für dessen energetische Nutzung. Rechtlich ist vieles ungeregelt und offen. Für eine Erdsonde zum Betrieb einer Heizung ist eine Konzession nötig – oder auch nur eine Bewilligung. Dazu Werner Ryter, Leiter Tiefbau und Planung der Stadt Zofingen: «Voraussetzung für eine solche Bewilligung sind Bohrversuche. Die Gesuche werden öffentlich aufgelegt und es gibt die Möglichkeit der Einsprache.» Wichtig: «Die Grenze, bis zu welcher Tiefe Erdwärmebohrungen ohne kantonale Konzession nach einem umweltrechtlichen Bewilligungsverfahren möglich sind, beträgt 400 Meter – in Anlehnung an eine SIA-Norm.» Für Ryter sind die in der Norm festgelegten 400 Meter «speziell» – sie werden vom Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) nicht begründet.
Nathalie Andenmatten, Geologin und Leiterin des Erdwärmeprogramms der Stadt Genf, meint: «Falls wir die Nutzung des Untergrunds nicht besser planen, besteht die Gefahr, dass wir uns technologische Entwicklungen der Zukunft verbauen.» Für Andenmatten sehr aktuell: «Wenn Behörden jetzt planlos zulassen, dass Privatpersonen ihre Sonden einrichten, haben in den betroffenen Zonen keine kollektiven Erdwärmesysteme mehr Platz.» Hier hakt Oliver Lateltin in der neusten Ausgabe von «Horizonte» (ein Magazin des Schweizerischen Nationalfonds) ein. Lateltin ist Bereichsleiter Landesgeologie bei Swisstopo und sagt: Während die Schweiz in der unterirdischen Ingenieurskunst brilliere, hinke der Gesetzgeber hinterher. Es gelte manchmal einzig das Gesetz «first come, first served».
Der Kanton Aargau hat mit seiner Verfassung von 1980 sechs kantonale Monopole festgehalten, darunter die Gewinnung von Bodenschätzen. Die Geothermie gehörte damals nicht dazu. Und wie Ryter feststellt, gibt es auch kein Monopol für die Sequestrierung – die Einlagerung – von CO im Untergrund.
Bauen in die Tiefe ist teuer
Wilder Westen im Untergrund? Könnte man also ein «Tiefhaus» anstelle eines baurechtlich in seiner Höhe begrenzten Hochhauses erstellen? Also zig Stockwerke in die Tiefe bauen?
«Es gibt keine gesetzliche Limitierung», sagt Ryter dazu, schränkt aber ein: «Das Bauen im Untergrund ist sehr teuer.» Es setze viele aufwendige Abklärungen voraus. «Die Nutzung des Untergrundes für Infrastrukturen geht selten – ausser bei Tunnels oder Leitungen – über zwei bis drei Untergeschosse für Tiefgaragen oder Lager hinaus.» Gegen eine intensive Nutzung sprechen – nebst den Kosten – Erdbebensicherheit, Statik, Erschliessung, das Raumklima und der Brandschutz.