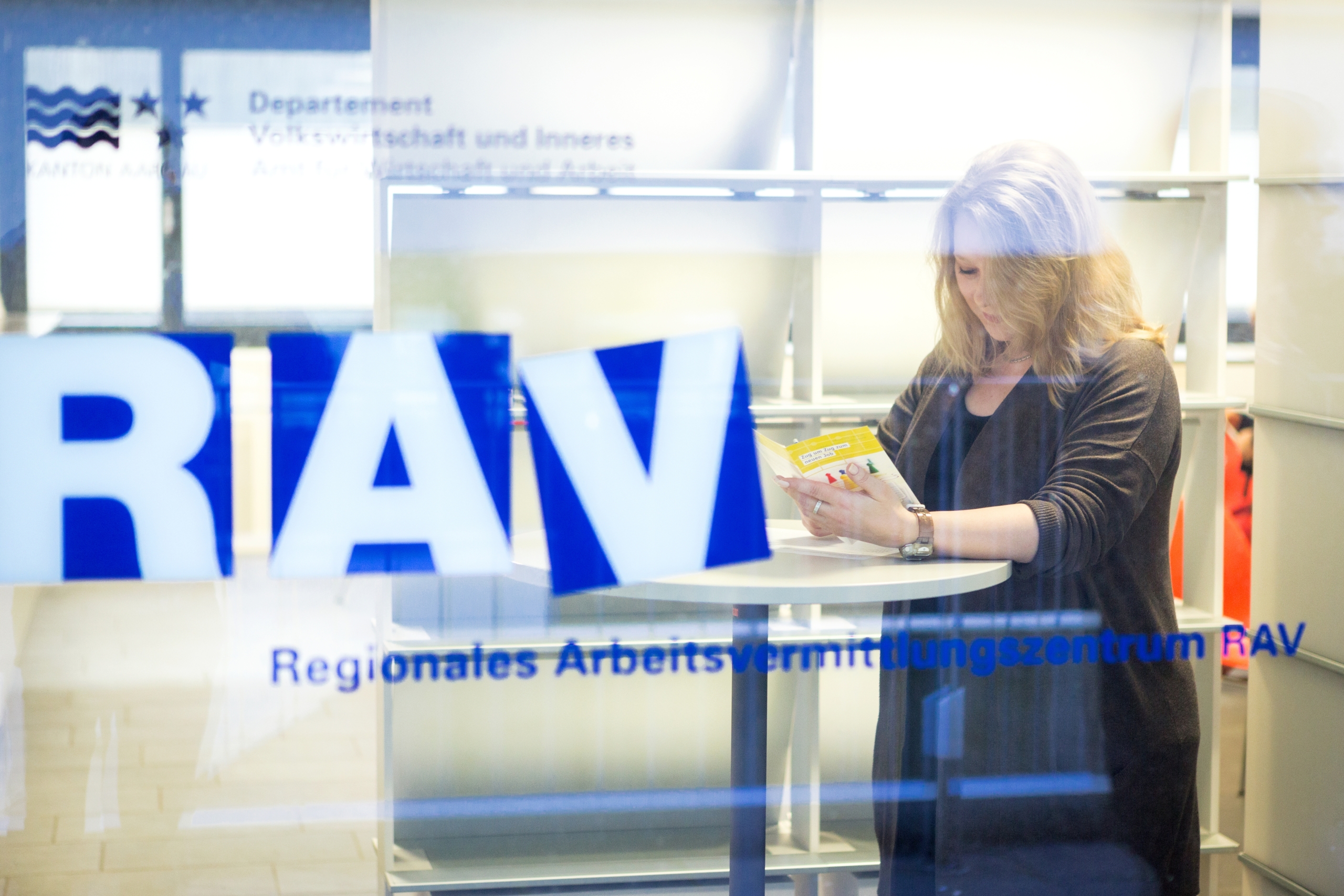Stetige Kontrolle, damit der Feuerbrand nicht ausbricht

Das warme und feuchte Wetter während der Kernobstblüte im April freute das Feuerbrand-Bakterium: Es kann sich bei dieser Witterung optimal ausbreiten. Der Feuerbrand befällt neben Kernobstbäumen auch verschiedene Sträucher, Cotoneaster und weitere Wirtspflanzen. Um die Bakterienkrankheit unter Kontrolle zu halten, verfügt jede Gemeinde im Aargau über mindestens einen Feuerbrandverantwortlichen. In Murgenthal sind Roberto Giger und Alfred Uebersax vom Bauamt dafür zuständig. Sie prüfen die gefährdeten Bäume und Pflanzen in den Hausgärten und Siedlungsgebieten auf einen möglichen Befall. «Wir befinden uns in der roten Zone», sagt Roberto Giger. Er spricht dabei von der sogenannten Befallszone, in der sich alle Gemeinden befinden, in denen der Feuerbrand schon einmal verstärkt auftrat. 54 Gemeinden hat der Kanton Aargau diesem Bereich bereits zugeordnet; die gesamte Region Zofingen gehört dazu.
Desinfektion ist wichtig
Roberto Giger ist heute auf einem Kontrollgang im Ortsteil Riken unterwegs. Er trägt eine Leuchtweste, die ihn zusammen mit dem entsprechenden Ausweis als Mitarbeiter des Bauamts kennzeichnet. Ausgerüstet ist er mit einem Feldstecher, Markierband und Desinfektionsmittel. Zu Fuss gehts durch die Einfamilienhaus-Quartiere. Die Sonne scheint, am Himmel sind kaum Wolken zu sehen. Für den Kontrollgang ist das Wetter wichtig. «Bei Regen sind wir nie unterwegs, weil wir das Bakterium durch die nassen Schuhe leicht weiterverbreiten könnten», erklärt er. Die meisten Gärten im Rikner Gebiet muss Roberto Giger gar nicht erst betreten, weil sie zur Strasse hin gelegen sind. Dort genügt ein Blick über den Zaun, um die Gesundheit der Bäume einzuschätzen. Für grössere Obstbaumplantagen oder Baumgärten nimmt er einen Feldstecher zu Hilfe. Berührt er eine Pflanze, desinfiziert er sich davor und danach gründlich die Hände. Hausbesitzer, die hie und da im Garten arbeiten und ihn entdecken, halten einen freundlichen Schwatz mit ihm. «Sie kennen uns inzwischen», sagt der Feuerbrandkontrolleur.
Traurige Baumbesitzer
Den letzten grossen Feuerbrand-Ausbruch verzeichnete Murgenthal in den Jahren 2006 und 2007. Damals musste das Bauamt viele betroffene Obstbäume fällen und an Ort und Stelle verbrennen, um eine weitere Ansteckung zu verhindern. Für viele Gartenbesitzer sei dies ein schwieriger Moment gewesen, weil sie mit dem betroffenen Baum besondere Erinnerungen verbanden. «Einige haben dabei fast geweint», erinnert sich Roberto Giger. Zum Beispiel, weil sie den Baum einst zur Geburt ihres Kindes gepflanzt hatten. Private Baumbesitzer erhalten zudem keinen Ersatz für ihren gefällten Baum. Landwirtschaftliche Betriebe, die von ihrer Obstbaumplantage leben und vom Feuerbrand betroffen sind, werden dagegen vom Kanton subventioniert. Er genehmigt dort unter strengen Bewilligungskriterien auch den Einsatz des Antibiotikums Streptomycin. Aber nicht jeder, der an Bäumen oder Pflanzen im Garten bräunliche Blätter entdeckt, muss sich gleich vor Feuerbrand fürchten. «Trockenheit oder Mäusebefall im Wurzelstock kann ebenso zu dürren Blättern führen», erklärt Roberto Giger anhand eines verwelkten Zweiges an einem Apfelbaum. Oft steckt auch die Pilzkrankheit Monilia dahinter, die im Gegensatz zum Feuerbrand leichter behandelt werden kann.
Schnelltest vor Ort
Charakteristisch für Feuerbrand ist, dass die Fäulnis von der Blattmitte her zum Rand führt; quasi den Blattnerven entlang wandert. Wer derartige Flecken an einem Obstbaum entdeckt, sollte den Pflanzenteil keinesfalls berühren, sondern den Feuerbrandkontrolleur der Gemeinde rufen. «Wir markieren den Baum und lassen ihn dann durch den Regio-Berater mittels Schnelltest vor Ort auf das Bakterium überprüfen», sagt Roberto Giger. Auf dem heutigen Kontrollgang findet er aber keine Verdachtsfälle: Die Blätter der Obstbäume in Riken leuchten in saftigem Grün.