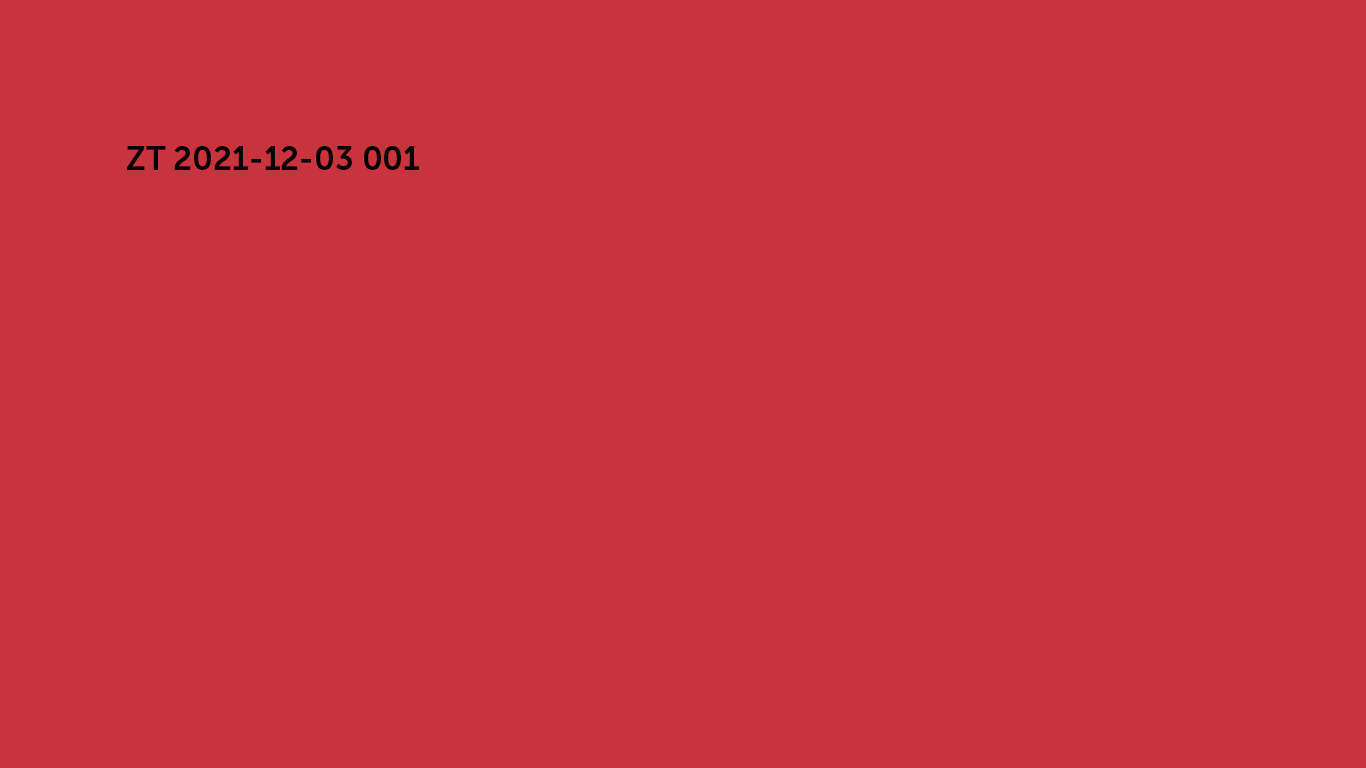DDR-Widerstandskämpfer zu Besuch in Luzern: „Ich wollte selbstbestimmt leben“
Wolfgang Welsch sitzt am Steuerrad und blickt apathisch durch das Loch. Dort hindurch, wo ihm eine Frontscheibe mal so was wie Sicherheit bot. Die Scheibe zerbarst durch ein Projektil einer Schusswaffe. Man wollte ihn töten, die Stasi wollte ihn töten. Er war ein Staatsfeind. Staatsfeind Nummer 1, so heisst auch sein Buch. Jetzt steht der mittlerweile 74-Jährige vor diesem an die Leinwand projizierten Bild in einem Schulzimmer der Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Seit Jahren besucht er Schulen und berichtet von seinem Widerstand in der sozialistischen Diktatur. Drei Tage lang besuchte er die Luzerner Kantonsschulen.
Herr Welsch, Sie halten hier an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern ein Referat über Menschenrechte. Was möchten Sie den Luzerner Schülern auf den Weg geben?
Wolfgang Welsch: Anhand meines Lebens in der DDR, in den Gefängnissen der Stasi möchte ich ihnen den Wert der Freiheit – dass man sich für Freiheit, für Recht und Demokratie einsetzen muss – vor Augen führen. Denn mein Leben ist dafür exemplarisch.
Wieso haben Sie sich so sehr gegen die DDR aufgelehnt?
Das begann bereits als Schüler. Da habe ich gemerkt, dass ich in diesem System quasi nur janusköpfig bestehen kann. Ich wollte aus diesem Land weg, ich wollte frei und selbstbestimmt leben. Und das liess sich eben in einer Diktatur nicht machen.
Waren sie ein Ausnahmefall unter den Jugendlichen?
Natürlich nicht. Das Gefängnis war voll mit jungen Leuten, Schülern und Studenten, jungen Arbeitern und Künstlern. Quasi die Blüte des Landes war im Gefängnis, weil sie eines wollten: frei sein. Wir wollten dieses Land verlassen. Und das hat man uns verwehrt. Deshalb waren wir als Staatsfeinde in Hochsicherheitszellen – wie Schwerverbrecher und Terroristen.
Sie waren rund sieben Jahre im Gefängnis. Hat sie diese Zeit nicht traumatisiert?
Natürlich war ich traumatisiert und bin es in gewisser Hinsicht immer noch. Inzwischen ist aber viel Zeit vergangen. Psychotherapie schlägt in solchen Fällen wohl kaum an. Die einzige Möglichkeit ist eine intellektuelle Aufarbeitung des Geschehenen: Ich habe viel darüber gesprochen und habe Bücher geschrieben. Und ich bin ja immer noch unterwegs, um vor Schülern oder anderen davon zu erzählen. Das hilft natürlich alles. Denn man kann es nicht verdrängen, man muss es vielmehr ins eigene Leben integrieren.
Die Stasi hat einen sogenannten IM, einen inoffiziellen Mitarbeiter, auf sie angesetzt. Der vermeintliche Freund wollte sie töten. Wie haben Sie gelernt, Menschen wieder zu vertrauen?
Das kann man mit einer kaputten Liebesbeziehung vergleichen: Wenn die Freundin weg ist, dann hat man im Moment vielleicht kein Bedürfnis nach einer neuen. Dann wartet man mal ab. Aber irgendwann kommt das Bedürfnis wieder. Und wenn eine neue Beziehung beginnt, muss man wieder Vertrauen schenken. Das heisst, man muss seine Achillesferse, seine verletzlichen Stellen zeigen, sonst wird kein Vertrauen entstehen. Das kann man lernen, man muss sich überwinden. Ich denke, das konnte ich. Ich habe viele Freunde, ich gehe auf Menschen zu und habe Vertrauen in sie. Und ich weiss, dass das, was ich erlebt habe, aktuell am Beispiel Deutschland nicht wieder vorkommt.
Kann man die Vorfälle mit einem aktuellen Beispiel vergleichen; mit der Türkei zum Beispiel?
Ja, aber es ist schon wesentlich härter gewesen in der DDR. In der Türkei gibt es immerhin noch Rudimente von Opposition: Radiosender oder Zeitungen, die ihre Meinung sagen können. Aber in der DDR war das völlig unmöglich, da gab es keine Nische, da konnte man sich nicht verbergen. Jeder Gedanke, der in irgendeiner Weise erkennen liess, der Protagonist ist Kritiker, wurde gegen einen verwendet. Die Janusköpfigkeit war deshalb sehr gross. Es gab deshalb keine Opposition. Was es gab – von der Gründung der DDR 1949 bis zum Ende 1989 –, war Widerstand in mannigfaltiger Form. Beispielsweise am 17. Juni 1953 mit dem Volksaufstand. Später war der Widerstand in verschiedener Art und Weise manifest. Ich war eines der Glieder in dieser Widerstandskette. Umso grösser der Druck wurde, umso widerständiger wurde ich.
Und Sie haben deshalb auch Gefängnisstrafen in Kauf genommen.
Ja, das kann man nicht als besonderen Mut bezeichnen. Ich habe sie in Kauf genommen, es liess sich nicht vermeiden, ich konnte nicht anders. Es war der unbedingte Wille, sich gegen Unrecht zu wenden. Ich konnte das Unrecht nicht wortlos hinnehmen. Das war der Antrieb.
Sie waren jetzt schon an einigen Schulen in Luzern. Wie haben Sie die Luzernern Schüler wahrgenommen? Ist die Sensibilität vorhanden?
Ich bin immer wieder überrascht über die Kantonsschulen in der Schweiz, vor allem im Raum Luzern. Anfangs dachte ich, was mache ich hier in der Schweiz an den Kantonsschulen? Aber auch jetzt wieder weiss ich, die Schüler sind sehr aufmerksam. Ich bin immer wieder überrascht, auf welche Fragen und Zustimmung ich stosse. Es gibt eine lebendige Diskussion nach meinen Vorträgen. Das Thema ist auch für die Schweiz relevant. Wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen. Das heisst: Mitarbeit ist gefordert. Jeder Einzelne ist gefordert, sich gegen beginnendes Unrecht, beginnende Schwarz-weiss-Malerei zu wenden.
Wolfgang Welsch ist im März 1944 in Berlin geboren. Er war politischer Gefangener in der DDR und anschliessend Fluchthelfer für Flüchtlinge aus der DDR. 1981 überlebte der Widerstandskämpfer nur knapp mehrere Mordanschläge von Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit. Wegen ernstzunehmender Morddrohungen ging Welsch nach dem Mauerfall von 1992 bis 1994 ins Ausland, unter anderem nach Costa Rica. Mittlerweile lebt er aber wieder in Deutschland. Wolfgang Welsch veröffentlichte verschiedene Bücher, darunter das wohl bekannteste mit dem Titel «Staatsfeind Nr. 1».