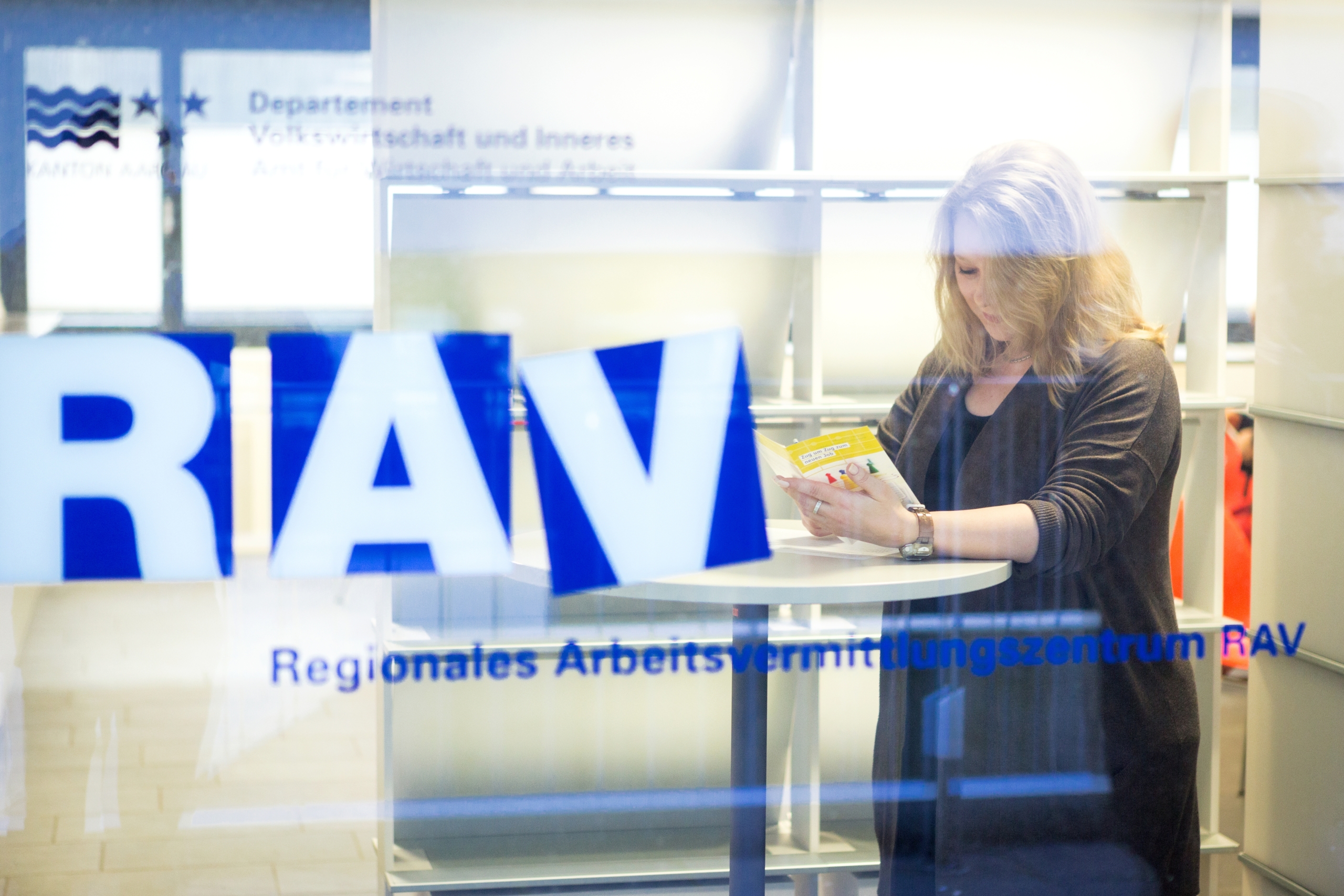Seine Erinnerungen füllen Bände
Lehrer Rolf Marti unterrichtet seit 40 Jahren an der Realschule Strengelbach – der Job macht ihm Spass wie eh und je.
Es ist still im Neumattschulhaus in Strengelbach. Die Kinder sind noch in den Sommerferien. Nur Lehrer Rolf Marti (60) aus Brittnau steht schon an der Wandtafel in seinem Schulzimmer und bereitet alles für den Montag vor. Dann geht die Schule wieder los – und das mittlerweile 40. Schuljahr für Rolf Marti: Seit 1977 unterrichtet er schon an der Realschule in Strengelbach. Es seien 40 ereignisreiche Jahre gewesen. «Ich könnte Bücher füllen mit meinen Erinnerungen», sagt Marti und lacht.
Wertvoll für die Gesellschaft
Ursprünglich wollte er Elektroingenieur werden. Ein Berufsberater riet ihm zum Lehrerseminar. «Er fand, ich hätte eine soziale Ader», erinnert er sich. Als Marti nach Abschluss des Seminars für ein Jahr als Vikar an die Realschule in Strengelbach kam, ahnte er nicht, dass noch 39 weitere Jahre an der gleichen Schule folgen würden. Vielmehr zweifelte er, ob er den Herausforderungen der Realschule, damals noch Oberschule genannt, gewachsen war. «Die Realschüler galten damals wie heute als Schulversager und Problemkinder.»
Kaum trat er aber die Stelle an, wandelte sich sein Bild der Jugendlichen. «Ich erkannte, wie wertvoll sie sind – auch für die Gesellschaft.» Viele von ihnen hätten im sozialen Bereich gute Kompetenzen mitgebracht, seien aber demotiviert gewesen, weil sie sich innerhalb des Schulsystems als Verlierer sahen. «Sie hatten den Ablöscher», sagt der Vater dreier erwachsener Kinder. «Ich habe versucht, ihnen zu zeigen, dass es im Leben nicht nur um Noten geht.» Das Wichtigste am Unterrichten sei, die Kinder zu mögen, sie zu verstehen, gerne mit ihnen zu arbeiten und ihnen ein gutes Umfeld zu ermöglichen. «Die Beziehung ist eigentlich am wichtigsten.» Martis Konzept fand bei Eltern und anderen Lehrern Anklang: Er wurde nach einem Jahr fest angestellt.
Multikulti im Klassenzimmer
Die Schüler von damals sind inzwischen längst erwachsen geworden und haben selbst Kinder, die Rolf Martis Unterricht besuchen. Vieles hat sich seitdem im Klassenzimmer verändert. Wo früher Hellraumprojektor und Röhrenfernseher standen, befinden sich heute Beamer und Computer. Statt Frontalunterricht und Abschreiben gibt es Diskussionsrunden und andere Lehr- und Lernformen. Bestand die Klasse in den Siebzigerjahren mehrheitlich aus Schülern Schweizer Herkunft, hat heute die Mehrheit der Klasse einen Migrationshintergrund. «Die Schule ist multikulti geworden», sagt Marti, welcher der Schule Strengelbach von 1981 bis 1992 als Rektor vorstand. Es ist ihm wichtig, die verschiedenen Kulturen unter einen Hut zu bringen, die in seinem Klassenzimmer aufeinandertreffen. Akzeptanz und Toleranz stehen dabei im Vordergrund.
Eine Anekdote ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: In den Neunzigerjahren, zur Zeit des Jugoslawienkriegs, besuchten drei Jungen aus Serbien, Kroatien und Albanien gemeinsam seinen Unterricht. Sie weigerten sich, nebeneinanderzusitzen, weil ihre Heimatländer Krieg gegeneinander führten. «Ich sagte ihnen, dass man sich in gewissen Situationen einfach zusammenraufen muss – das gilt auch für die Schule», sagt Marti. Am darauffolgenden Sporttag habe der Vortrag Wirkung gezeigt: Die drei sassen während einer Spielpause zusammen auf einer Bank. «Obwohl wir eigentlich Feinde sind», habe einer der Jungen gemeint.
Keine «Strichli-Liste»
Doch der Lehrer kann nicht nur von Erfolgsgeschichten berichten. Kürzlich habe er es mit einem Problemschüler zu tun gehabt, der schon seit der ersten Klasse auffällig gewesen war. Der Junge, traumatisiert durch Ereignisse in der frühen Kindheit, kam täglich zu spät zum Unterricht, weigerte sich, Hausaufgaben zu lösen, und stachelte Mitschüler zum Mitmachen an. «Ich blieb ruhig und liess mich nicht provozieren», sagt Marti. «Ich stellte ihn nicht vor die Tür, sondern liess ihn die Hausaufgaben in der Stunde nachholen.» Er gelte bei seinen Schülern als streng, verfolge eine klare Linie – aber ohne eine «Strichli-Liste» zu führen.
Lieber gehe er individuell auf den einzelnen Schüler ein. «Jeder hat einen anderen Hintergrund, den ich berücksichtige.» Im Fall des Problemschülers habe aber auch diese Methode nicht geholfen: Der Schüler musste schliesslich mithilfe der Eltern, der Schulleitung und des schulpsychologischen Dienstes in ein Heim eingewiesen werden. «Das war besser für ihn und für die Klasse.» Von solchen Rückfällen lässt sich Rolf Marti aber nicht entmutigen. «Wir beginnen jeden Tag und jedes Schuljahr immer wieder neu.» So auch wieder am nächsten Montag.