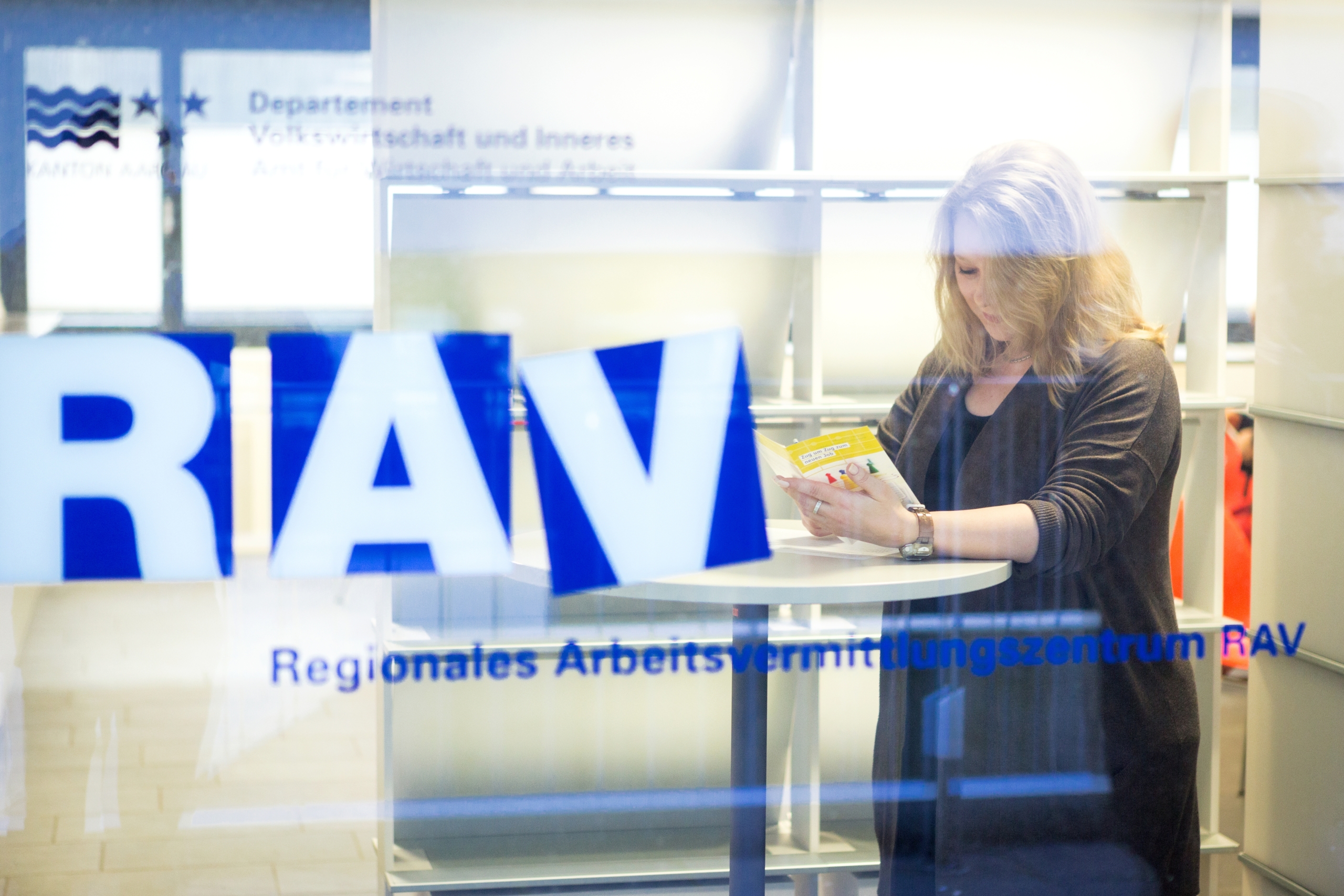«Wir wollen die rote Laterne abgeben»
Martin Amacher, der neue Leiter der Sozialdienste Aarburg, über Visionen, Altlasten, Probleme und Chancen.
Aarburg ist eine Sozialhilfehochburg, hat viele Flüchtlinge und die höchste Sozialhilfequote im Kanton. Ich behaupte: Da können Sie als neuer Sozialdienstchef ja eigentlich gar nichts mehr falsch machen, oder?
Martin Amacher: Ich würde das nicht so sehen. Schlechter geht immer. Es geht darum, warum ich angestellt wurde: Weil ich Personalexperte mit Führungserfahrung bin. Ich will zuerst den Fokus nach innen, in die Verwaltung, richten. Ich will aber auch die Aussensicht, die Arbeit der Sozialarbeitenden, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Ämtern sowie mit der Bevölkerung nicht vergessen.
Was bringen Sie mit, was die vorherigen Chefs nicht hatten?
In letzter Zeit gab es einige Veränderungen im Aarburger Sozialdienst, dies auch durch die politisch angestossene Reorganisation. Die Leitung hat in relativ kurzer Zeit mehrfach gewechselt. Deshalb will ich zuallererst wieder Ruhe ins Gefüge, ins Team, bringen. Das Rad dreht sich immer schneller, da müssen wir am Ball bleiben. Gefreut hat mich mein erster Vorstellungstermin im Rathaus. Da wurde mir bewusst, dass hier ein motiviertes Team zugange ist. Das war für mich wichtig, um zu sagen: «Doch, hier will ich mitmachen und etwas bewirken.» Es gab kritische Blicke, aber auch sehr motivierte.
Warum kritische Blicke?
Die Mitarbeitenden hatten es in letzter Zeit nicht immer einfach, weil nicht immer alles optimal lief. Einen neuen Chef begrüsst man mit einer gesunden Portion Misstrauen. Jede Veränderung bringt Verunsicherung und Ungewissheiten mit sich.
Wo wollen Sie erste Nägel einschlagen oder die Schraube anziehen?
Bei der internen Kommunikation. Diese war, denke ich, keine grosse Stärke. Es wurde viel diskutiert, aber ebenso vieles wurde nicht transparent mitgeteilt, sodass die Mitarbeitenden oft nicht wussten, was der Kurs und das Ziel sind. Es braucht Transparenz. Das bringt Halt. Halt bringt Vertrauen.
Ihr Werdegang als Führungskraft, Coach und Development-Spezialist lässt vermuten, dass ein knallharter Manager aufräumen will.
Das ist ein ganz falscher Eindruck. Nebst meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung habe ich auch Psychologie studiert und einen Master in Coaching absolviert. Deshalb sehe ich mich in einer Brückenfunktion: einerseits klar sachlich orientiert, andererseits aber menschlich und empathisch. Ich denke, das ist für den Sozialdienst im Moment eine wichtige Funktion. Auf einer Seite Klarheit mit den Zahlen und Zielen zu haben, auf der anderen Seite das Zwischenmenschliche nicht zu vergessen. Es soll eine schöne Balance herrschen. Das heisst auch, die Mitarbeitenden in die Zieldefinition und -erreichung aktiv miteinbeziehen.
Sie sprechen von Zahlen. Warum? Sind Sie auf ein Chaos gestossen?
Ich meine auch, dass wir klare Ziele haben müssen. Zum Beispiel bei der Sozialhilfequote. Da hatten wir letztes Jahr schon einen Rückgang, von 5,9 auf 5,3. Das müssen wir klar weiterverfolgen, dann können wir auch Kosten senken. Dafür brauchen wir aber klare Massnahmen. Auch im Team. Wir erarbeiten zum Beispiel ein Kompetenzenmodell, woran sich jeder Sozialarbeiter halten muss.
Worum geht es dabei konkret?
Das sind Richtlinien ähnlich der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Diese legen wir auf kommunaler Ebene neu fest. Dabei geht es um einfache Fragen wie: Wie viel erhält ein Klient für ein Brillengestell? Aber auch komplexere Fragestellungen, wie: Wie weit geht ein Sozialarbeiter in der Begleitung und Betreuung eines Klienten? Muss er beispielsweise noch bei der Wohnungssuche mithelfen? Damit wir hier eine einheitliche Linie haben, braucht es klare Vorgaben.
Was muss sich noch ändern?
Nebst den klaren Kompetenzrichtlinien, die ein einheitliches Vorgehen gegenüber Klienten versprechen, gibt es Altlasten aufzuarbeiten. Zum Beispiel nicht zu Ende geführte Quartalsabrechnungen. Da können wir noch Geld einfordern, etwa von der Aargauer Sozialversicherung SVA oder dem Kanton. Grundsätzlich ist schon vieles bereits aufgegleist worden vor meinem Antritt.
Die Reorganisation des Sozialamts unter Gemeinderätin Martina Bircher führt in eine gute Richtung?
Genau. Wir haben in vielen Dingen ähnliche Vorstellungen. Ein Beispiel: Für die ganzen KESR-Mandate (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) fehlen uns die Leute, die die nötigen Voraussetzungen oder die Akzeptanz beim Familiengericht haben. Auch das sind Altlasten. Da hat es bereits Gespräche gegeben und jetzt arbeiten wir das auf, was liegengeblieben ist, und zwar mit einer externen Sozialfirma, der Tangente GmbH aus Solothurn. Diese führt die Mandate weiter, die der ehemalige Sozialdienstleiter hatte. Konkreter kann ich aus Datenschutzgründen nicht werden.
Haben Sie genügend Leute?
So wie der Aufwand sich momentan darstellt, sind wir gut aufgestellt. Aktuell sind wir 13 Mitarbeitende.
Zum Thema Sozialhilfekosten. Der Kanton Bern weist jährlich die Kosten pro Fall für jede Gemeinde aus. Der Aargau macht das nicht. Wie steht es um die Fallkosten in Aarburg – sind die ebenso wie die Quote unverhältnismässig hoch?
Aarburg hat die «rote Laterne» betreffend Gesamt-Sozialhilfekosten. Im Kanton sind wir klares Schlusslicht. Was die durchschnittlichen Kosten pro Fall anbelangt, kann ich aktuell noch keine Zahlen vorweisen.
Die Gesamtkosten müssen aber gesenkt werden?
Eindeutig, das ist das Ziel. Das ist bereits in unserer Strategie definiert, damit wir die «rote Laterne» abgeben können.
Was können die Gemeinden tun?
Wenn es um ausländische Sozialhilfeempfänger – anerkannte Flüchtlinge – geht, müsste man eigentlich auf übergeordneter Ebene ansetzen, da ist die Politik gefragt. Für mich ist wichtig, dass Integrationsmassnahmen früh ansetzen: Bereits, wenn eine Person in die Schweiz kommt, müssen die Prozesse klar sein. Das ist meiner Meinung nach aber in der Pflicht von Kanton und Bund. Die Gemeinde wird dann erst als ausführendes Organ einbezogen.
Sind die heutigen Prozesse zu lasch, zu unklar?
So würde ich es nicht nennen. Meiner Ansicht nach sind sie zu wenig aufeinander abgestimmt. Es gibt sehr viele und sehr gute Integrationsprojekte. Aber keine übergeordnete Koordinationsstelle. Es ist für mich «Pflästerli-Taktik». Da verpufft viel an gutem Willen und Ressourcen. Ich spreche klare Prozesse im Integrationsbereich an. Worauf schaue ich? Wie gehe ich vor? Wo fange ich an? Man weiss: Kommunikation und Sprache ist das wichtigste Integrationsmittel, deshalb muss man dort Prioritäten setzen. Und wenn jemand einen Deutschkurs besucht, muss man den Erfolg klar messen und überprüfen. Ist er nicht da, wird untersucht, woran das liegt. Darüber hinaus geht es um Aspekte wie Wertvorstellungen der Schweiz. Das fängt schon dabei an, wie man ein WC benützt – dass unsere Toiletten keine Plumpsklos sind. Aber auch Pünktlichkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Die Leute sollten die kulturellen Gepflogenheiten kennen. Die Vermischung der Kulturen ist meiner Meinung nach aber für beide Seiten interessant und bereichernd.
Sind Projekte in der Pipeline?
Wir werden mit der «Tangente» ein Integrationsprojekt starten. Der Fokus zu Beginn liegt auf den unter 25-Jährigen, damit wir diese wieder oder überhaupt in den Arbeitsmarkt integrieren können. Das gibt eine gewisse Langfristigkeit. Die Jungen würden sehr lange in der Sozialhilfe bleiben. Später wird das Projekt auf ältere Klienten ausgebaut.
Die Frage, wer etwas gegen die sozialen Probleme tun muss, wird in den Augen der Öffentlichkeit oft nur hin- und hergeschoben. Zu Recht?
Ich denke, wenn die Prozesse und Abläufe klar definiert sind, dann hat man dieses föderalistische Problem, das wir ja beispielsweise auch in den Schulen haben, gelöst. Aber: Heute gibt es eine Tendenz, dass man tatsächlich die heisse Kartoffel hin- und herreicht. Und das ist sicherlich keine Lösung.
Sie sprachen von Rechten und Pflichten von Sozialhilfeempfängern. Das regelmässige, engmaschige Begleiten ist zentral.
Deshalb arbeiten wir daran. Unsere Sozialarbeiter sollen die Klienten regelmässiger sehen und klare Auflagen machen. Werden diese Auflagen nicht erfüllt, wird überprüft, warum das so ist, und womöglich sind Restriktionen nötig. Natürlich immer verhältnismässig.
Wenn nötig, muss hart durchgegriffen werden. Wurde zu lange ein Kuschelkurs gefahren?
Für mich ist wichtig, immer beide Seiten im Fokus zu halten. Klienten fördern, aber auch fordern. Es gibt keine Lösung für alle. Wie schon erwähnt braucht es eine betriebswirtschaftliche und eine zwischenmenschliche Komponente. Hat man klare Kompetenzvorgaben, hat man auch einen Rahmen. Das fehlte bisher. Deshalb bauen wir das auf. Von heute auf morgen geht das jedoch nicht.
Es werden neu Zielvereinbarungen abgeschlossen, eine Art Verträge, was vom Klienten erwartet wird.
Diese führen wir sukzessive ein. Dazu gehört aber auch eine Chancenschätzung. Dass wir beispielsweise wissen, welche Massnahmen sich lohnen, aber auch, welche nicht. Wir wollen vermehrt eine personenzentrierte Strategie verfolgen unter dem Stichwort «hart, aber fair». Dies bedeutet, dass klare Rahmenbedingungen bestehen, diese jedoch je nach Individuum entsprechend eingesetzt werden.
Wo liegt die grösste Schwierigkeit in Aarburg?
Meiner Meinung nach kann man nicht von der grössten Schwierigkeit sprechen. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Die Zusammensetzung der Bevölkerung, der hohe Anteil an Ausländern, der zum Teil billige Wohnraum, keine klaren Richtlinien vom Bund.
Aarburg hat viele Flüchtlinge, die meisten ohne Ausbildung . . .
Dort ist ein klarer Integrationsansatz wichtig. In Sursee etwa gibt es ein Projekt für die Lehrlingsausbildung für Flüchtlinge. Das funktioniert gut, wird aber vom Kanton Luzern gesteuert. Wir in Aarburg gehen dieses Thema mit dem neuen Integrationsprojekt an. Auch überprüfen wir vermehrt die Fortschritte von Personen, welche eine Massnahme in Anspruch nahmen.
Flüchtlinge sind ein wesentlicher Faktor für hohe Sozialhilfekosten?
Ja, im Moment sind sie das. Wichtig ist hier der Austausch mit anderen Gemeinden, die ähnliche Probleme haben. Das beginnt bei verschiedenen Integrationsprojekten, es braucht mehr regionale Koordination. Sonst verzettelt sich das Ganze. Es braucht ein übergeordnetes Konzept. Im Kanton Luzern begleitete ich Jugendliche bei Lehrlingsprogrammen. Quasi identische Projekte wurden von drei verschiedenen Stellen geführt. Das macht einfach keinen Sinn.
Es gibt Firmen, die im Sozialwesen ein gutes Geschäft wittern. Einen wachsenden Sozialapparat. Betreffend Koordination: Wäre eine grosse Sozialfirma für die ganze Region ein gangbarer Weg oder einfach nur teuer?
Das ist schwer zu sagen. Es hat Vor- und Nachteile. Konzentriert man alles, geht es in Richtung Monopol. Aber Vielfältigkeit belebt den Markt. Ich denke, es müssten zum Teil auch politische Richtlinien vorgegeben werden, in denen sich Anbieter und Sozialfirmen bewegen müssen.
Es darf nicht darum gehen, aus Armut und Leid Geld zu machen.
Genau. Ob sich heute alle daran halten? Das beantworte ich nur mit einem grossen Fragezeichen.