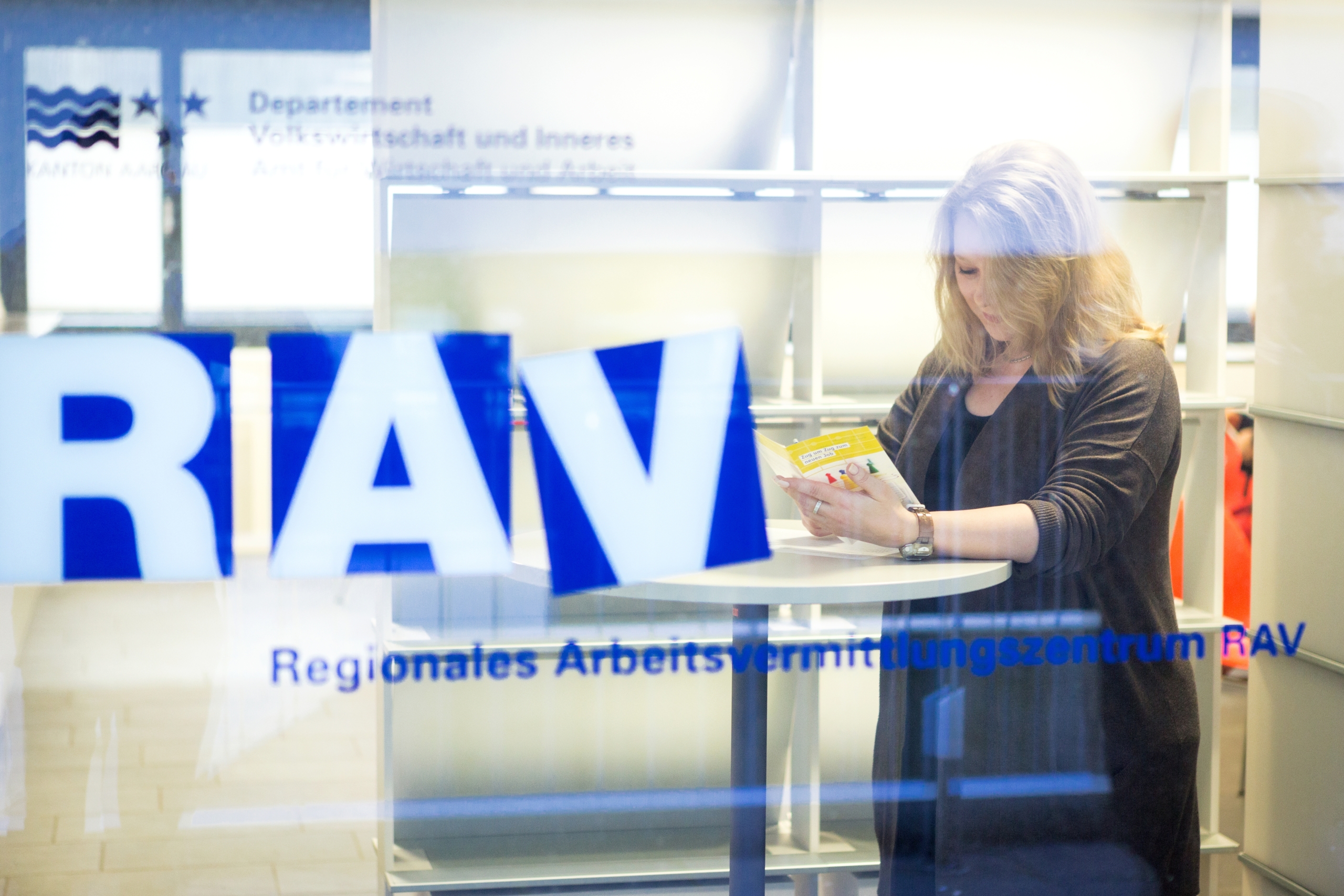Analyse: «Sind Schulpflegen nötige Scharniere?»
Im Aargau kommt das Dossier «Führungsstrukturen der Volksschule» erneut aufs Tapet – der Regierungsrat hat die Akten wieder zur Hand genommen, weil er noch immer Handlungsbedarf sieht. Ziel einer neuen Vorlage bleibe, die Steuerung der Volksschule zu vereinfachen und die Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Gremien zu klären.
Um was geht es? Die Schulen im Kanton Aargau sollen nicht mehr durch Schulpflegen geführt werden. Die Regierung plante die Abschaffung dieser Behörden bereits vor fünf Jahren. Wegen überwiegend negativer Reaktionen wurde das Vorhaben auf Eis gelegt. Nun nimmt der Regierungsrat einen neuen Anlauf: Bis zum Herbst soll der Plan konkret werden.
Die Führungsstruktur der Aargauer Volksschule ist komplex. 1805 als Gemeindeschule ins Leben gerufen und damit weitgehend den Kommunen überlassen, wurde sie mehr und mehr zentralisiert. Immer stärker wurden inzwischen nicht nur die Einflüsse von Kanton und Bund (Harmonisierung von Schuldauer und Lerninhalten). Die Aufteilung wirkte sich auch auf die Kostenträgerschaft aus. Bis 1920 war die Besoldung der Lehrkräfte im Aargau eine Aufgabe der Gemeinden und nicht des Kantons.
Vor Ort, in der Gemeinde, wird die Schule durch die vom Volk gewählte Schulpflege geführt. Sie hat jedoch keinerlei Finanzkompetenzen. Diese liegen beim Gemeinderat, der damit wichtige Entscheide in Schulfragen trifft, ohne auf der anderen Seite Führungsverantwortung zu tragen. Direkt geführt werden Schule und Lehrkräfte seit einigen Jahren durch professionelle Schulleitungen und nicht mehr durch die Milizbehörde Schulpflege.
Vor diesem Hintergrund machte der Regierungsrat vor fünf Jahren den Vorschlag, die Führungsstrukturen zu verschlanken und künftig auf Schulpflegen zu verzichten. Die strategische Führung der Schule sollte künftig direkt in die Hände des Gemeinderates gelegt werden. Wenn dieser will, kann er eine Schulkommission berufen und sich durch diese fachlich beraten lassen.
Kaum wurde damals das regierungsrätliche Papier in Vernehmlassung gegeben, meldeten sich die Betroffenen. Skeptisch zeigte sich damals der Verband der Schulpflegepräsidentinnen und -präsidenten: «Wir befürchten eine Überlastung vieler Schulleitungen, eine Konzentration der strategischen Führung auf eine Einzelperson, den Ressortleiter Schule im Gemeinderat – und einen Eingriff in die Gemeindeautonomie, wenn dem Volk das Wahlrecht für die Schulpflege entzogen wird.»
Ist dem so? Im Vergleich mit 1805 ja. 2018 sind jedoch Einflussnahme und Verantwortung der Gemeinden primär auf Personalführung, Schulhäuser und deren Ausstattung beschränkt. Über Lehrplan, über personelle Ressourcen oder Anzahl Schülerinnen und Schüler in einer Klasse entscheidet der Kanton.
Was verliert man an demokratischer Mitwirkung, wenn eine Führungsebene wegfällt, durch den gewählten Gemeinderat ersetzt wird? Lehrerinnen und Lehrer wurden bis 2005 von Schulpflege und Gemeinderat in einer gemeinsamen Sitzung gewählt. Gegen positive und negative Wahlbeschlüsse konnten fünf Prozent der Stimmberechtigten ein Referendum erzwingen. Über Wahl oder Nichtwahl wurde in diesem Fall an der Urne entschieden. Heute sind die Lehrkräfte Angestellte der Schule.
Beschränkte kommunale Einflussmöglichkeiten und immer mehr Gemeinden, in welchen zwar ein Schulhaus steht, in welchem aber keine Schule mehr erteilt wird – macht da eine zwischen Kanton und Gemeinde aufgeteilte Schulträgerschaft noch Sinn? Die Kostenseite ausgeklammert (der Staat müsste die vollen Löhne übernehmen und die Schulhäuser finanzieren) kaum. Dass eine auf den ganzen Kanton ausgerichtete und hierarchisch mit dem Bildungsdirektor an der Spitze geführte Schule in der föderalistisch verstandenen Gemeindelandschaft des Aargaus kein mehrheitsfähiges Thema sein dürfte, ist ebenso klar. – Das gilt auch für die Idee, aus Kreisschulen eigenständige politische Körperschaften (Schulgemeinden) zu formen.