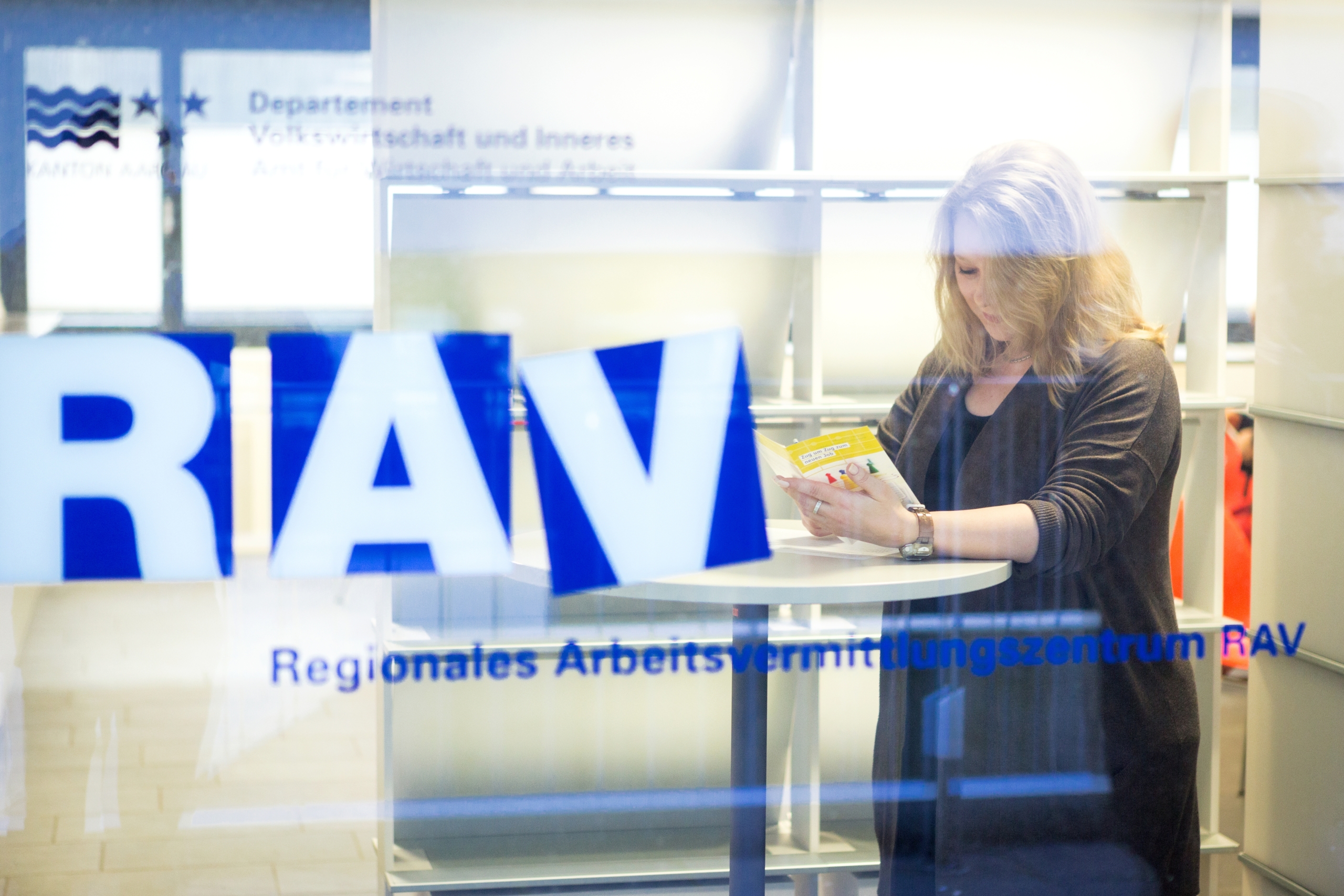Anita Winter: «Das Trauma meiner Eltern lag wie ein Schatten über allem»
Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Vielleicht gibt es schon in zehn Jahren gar keine mehr. Niemand, der vom Grauen der NS-Zeit erzählen kann, weil er es selbst erlebt und den Holocaust überlebt hat. Anita Winter setzt sich dafür ein, dass die Geschichten nicht vergessen gehen. Sie gehört zur zweiten Generation. Ihre Eltern sind beide vor dem Krieg in Deutschland geboren – der Vater 1922 in Heilbronn, die Mutter 1934 in Nürnberg – und haben den Holocaust überlebt. Ihr Vater erlebte die Reichspogromnacht alleine in Berlin, versteckt hinter einem Schrank. Ihm gelang die Flucht in die Schweiz. Ihre Mutter sprang als Kind aus einem Deportationszug, war ständig auf der Flucht, lebte im Versteck und später zeitweise unter falschem Namen in einem christlichen Kloster in Frankreich.
Von ihren Eltern lernte Anita Winter früh, nicht an Materiellem zu hängen. Für sie war es normal, dass Mäntel und Pässe immer bereitlagen, damit die Familie innert allerkürzester Zeit hätte fliehen können, so wie es ihre Mutter im Krieg oft musste.
Die Schulzeit verbrachte Anita Winter in Baden. Sie war die einzige jüdische Schülerin in einer nichtjüdischen Welt und musste sich schon früh immer wieder erklären. Ihre Eltern hatten sie religiös erzogen. Auf Schulausflügen konnte sie keine Bratwurst essen, weil diese nicht koscher ist. Am Samstag ging sie zwar zur Schule, schrieb aber keine Prüfungen. Anita Winter war anders als die anderen Kinder. Sie wusste, dass ihre Eltern den Holocaust überlebt hatten. «Ihr Trauma lag wie ein Schatten über allem.»
Die Mutter schwieg
Was genau ihre Eltern durchgemacht haben, das wusste sie lange nicht. Der Vater erzählte viel vom Krieg und hielt auch Vorträge in Schulen. Die Mutter aber schwieg. «Wahrscheinlich wollte sie uns Kinder schützen oder war noch nicht bereit, darüber zu sprechen.» Als Kind und Jugendliche hat Anita Winter ihrer Mutter kaum Fragen gestellt. «Ich wusste, dass meine Mutter weinen würde, wenn ich sie nach dem Krieg frage. Deshalb sagte ich ihr immer, ich wisse alles.»
Es waren aber lange nur Puzzleteile. Viele Verwandte, die nicht mehr da waren oder fehlende Erinnerungsstücke. Es gab zum Beispiel kein altes Spielzeug aus der Kindheit der Eltern und auch kaum ein Kinder- oder Familienfoto. Dafür erinnert sich Anita Winter an die Albträume ihrer Mutter und daran, wie sich diese abwenden musste, wenn am Bahnhof Baden ein Güterzug vorbeirauschte. Es erinnerte sie an die Deportationszüge.
Details über das Leben ihrer Eltern während des Kriegs hat Anita Winter aber erst durch ihre eigenen Kinder erfahren. Sie seien viel unverkrampfter auf die Grosseltern zugegangen. Ihr ältester Sohn hat als Maturarbeit ein Buch über das Überleben seiner Grosseltern im Zweiten Weltkrieg geschrieben. «Er sass viele Stunden mit ihnen zusammen und hat jene Fragen gestellt, die ich nicht wagte zu stellen», sagt Anita Winter.
Die Geschichten und Erlebnisse von Holocaust-Überlebenden, die teilweise kaum in Worte gefasst werden können, berühren Anita Winter zutiefst. Es sei die Verantwortung ihrer Generation, dafür zu kämpfen, dass sich das Grauen nie wiederholt, und der Holocaust nie vergessen geht. Mit jedem Zeitzeugen, der stirbt und nicht mehr berichten kann, werde das schwieriger. «Wir werden die Zeitzeugen nie ersetzen können», ist sich Anita Winter bewusst. «Deshalb muss unsere Generation eine eigene Sprache finden, um den Schrecken des Holocausts an die nächsten Generationen weiterzugeben.»
2014 gründete sie die Stiftung «Gamaraal», die sich für bedürftige Holocaust-Überlebende einsetzt. Ausserdem leistet die Stiftung Aufklärungsarbeit, zum Beispiel an Schulen und Universitäten. Zusammen mit dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich hat sie die Wanderausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» konzipiert. Die Ausstellung zeigt anhand der Biografien der Überlebenden, wohin Antisemitismus führen kann. Am kommenden Montag wird in Bern im Rahmen des Internationalen Holocaust- Gedenktages eine neue Ausstellung der Stiftung eröffnet. Gezeigt werden Bilder von Fishel Rabinowicz, einem Holocaust-Überlebenden, der so seine Vergangenheit verarbeitet (siehe Fusszeile).
Fishel Rabinowicz wurde 1924 in Polen geboren. Er überlebte den Krieg in diversen Konzentrationslagern und erlebte die Befreiung in Buchenwald. 1947 kam er in die Schweiz. Seit seiner Pensionierung verarbeitet er seine Biografie in grafischen Bildern. Informationen zur neuen Ausstellung «Holocaust Artist» gibt es ab Montag auf der Website der Stiftung: www.gamaraal.org